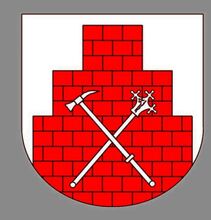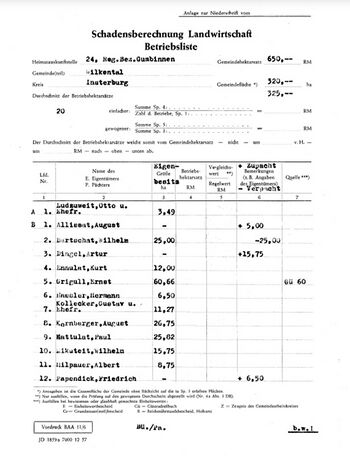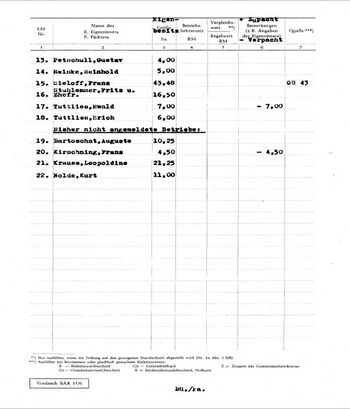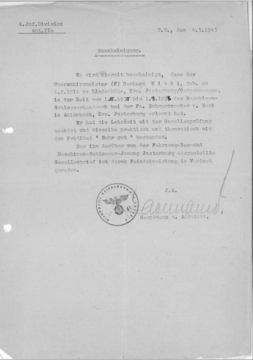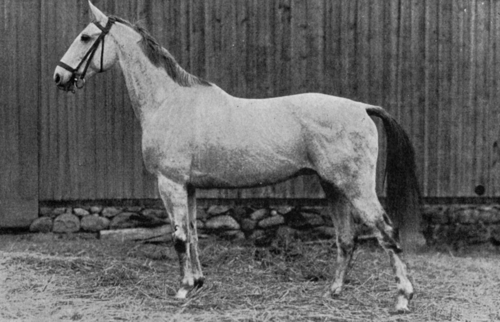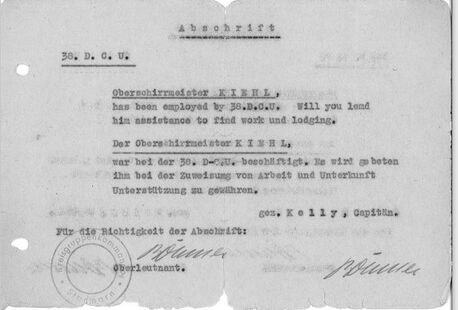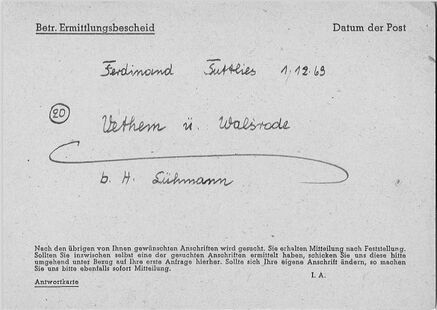Willschicken
W i l l s c h i c k e n - E r i n n e r u n g e n Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.) |
Hierachie:
Regional > Deutsches Reich > Ostpreußen > Regierungsbezirk Gumbinnen > Landkreis Insterburg > Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.) >Willschicken
| Ort und Gemeinde | |
| Willschicken | |
| Kirchspiel Aulowönen (Ostp.) | |
| Provinz : | Ostpreußen (nördliches) |
| Regierungsbezirk : | Gumbinnen |
| Landkreis : | Insterburg [1] |
| Amtsbezirk : | Groß Franzdorf (Franzdorf) [2] |
| Gegründet : | vor 1675 |
| Frühere Name : | Wilpischen (um 1785) Wilschicken (nach 1785) |
| Einwohner (1905) : | 150 |
| Orts-ID : | 62435 (nach D. Lange) |
| Geographische Lage | |
| Koordinaten : | N 54° 80′ 55″ - O 21° 82′ 44″
|
Einleitung
Bei der Beschreibung von Willschicken wurde auf die erreichbaren privaten und öffentlichen Quellen zurückgegriffen. Der so entstandene Text soll aber nicht nur Sachinformationen vermitteln - sondern er sollen auch die 2023 noch vorhandenen persönlichen Erinnerungen der Tuttliesen und der Kiehls aus und über Ostpreußen und Willschicken aufschreiben. Der vorliegende Text enthält ein Rückblick auf Kindheit und Jugend in Willschicken, die Flucht und den Neuanfang in Vennebrügge. Subjektive Wahrnehmungen und nachträgliche Erinnerungen schließen auch Fehler und Lücken mit ein. So z. B. das Erinnern an das Erinnerte. Zur Quellenlage siehe im Text Ländliche Entwicklung in Ostpreußen das Kapitel "2.2 Quellenlage".
Im Folgenden wird Willschicken bzw. Wilkental aus unterschiedlichen Sichtweisen beschrieben.
- Zunächst wird von Willschicken anhand von GenWiki - Standards und dann in drei Textteilen berichtet.
- Einmal wird die Dorfentwicklung aus der Sicht der Familien Tuttlies und Kiehl in Teil eins berichtet.
- In einem zweiten Teil kommt die Erinnerung von Hildegard Kiehl geb. Tuttlies zur Sprache.
- In einem dritten, separaten Teil geht es um die Entwicklungen in und zwischen Land, Provinz und Gemeinde. Klaus Kiehl hat in einer Recherche eine kleine Zeitreise mit vielen detaillierten Hintergrundinformationen verfasst. Dieser Bericht befindet sich unter dem Link: Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)
Die Idee zu den drei Teilen hatte Hildegard Kiehl, die eigene Erinnerungen zu den Teilen eins und drei beigesteuert hat und den zweiten Teil größtenteils selbst verfasst hat. Die Teile eins und drei wurden aufgeschrieben von Klaus Kiehl - Nachfahre der Familien Tuttlies aus Willschicken und Kiehl aus Pillwogallen, in Hamburg 2023.
Allgemeine Information
Ortsbeschreibung
Willschicken war ursprünglich ein Chatouldorf und später eine Gemeinde im Kirchspiel Aulowönen in Ostpreußen.

Willschicken gehörte zum Regierungsbezirk Gumbinnen. Das zuständige Landkreis-Amt, Amtsgericht und Bezirkskommando waren in Insterburg zu Hause. In Aulowönen / Aulenbach lag das Standesamt, die Post und Gendarmerie. Die Eisenbahnstation der Kleinbahn war von Willschicken in Aulenbach in 3,2 km zu erreichen. Sie verkehrte zwischen Insterburg und Groß Skaisgirren. Die Schule lag in Pillwogallen / (Lindenhöhe), Amt Franzdorf. Die Gemeinde lag von Insterburg 22 km entfernt. Willschicken gehörte zu ”Preußisch Litauen oder ”Klein Litauen” (Lithuania minor), dem nordöstlichen Teil des alten Ostpreußen. Hier wurde lange Zeit auch Litauisch gesprochen. Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch. Willschicken hatte 1912 gezählte 168 Einwohner und war 320 ha groß.
Quelle: Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches 1912 [2]
Ortsnamen
Es gab im Laufe der Zeit drei Namensänderungen:
- Wilpischen - erste Namensnennung um 1657,
- Wilschicken - Schreibweise nach 1785,
- Wilkental - Namensänderung am 16.07.1938
Willschicken existiert als Dorf seit 1948 nicht mehr.
Willschicken, litauisch wilszikei = Schimpfname; Wilpischen, litauisch wilpiszys = die wilde Katze
Geschichte von Wilpischen / Willschicken / Wilkental
Aufgrund der Datenlage wird bei den Geschichtserinnerungen hauptsächlich auf die Bevölkerungsentwicklung eingegangen. Die folgenden subjektiv ausgewählten 30 geschichtlichen Zeitpunkte zu Willschicken und der Umgebung werden im Text "Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.)" in Kapitel 3 näher erläutert.
- Ostpreußen und der Deutsche Orden 1226 - 1525
- Beginn der Ostsiedlung im Nadrauer Gebiet ab 1226. Hier werden später die Willschicker siedeln
- Die Altstadt von Königsberg war der Hanse 1339 beigetreten
- Die Festung namens Instierburg wird 1336 errichte
- Im Gebiet des späteren Kirchspiel Aulowönen wird ab 1531 die Türkensteuer erhoben
- Die ersten Preußischen Herrscher und deren Einfluss auf die ländliche Entwicklung in Ostpreußen von 1525 - 1786
- Die Gegend um Wilpischen wurde zuerst um 1657 als „Siedel Plaz by 2 Gehülfen“ erwähnt
- Der Tatareneinfall in Preußisch-Litauen erfolgte in den Jahren 1656/57
- Im Jahre 1678 wird ein preußischer Waldwart in der Siedlung Wilpischen genannt
- Willschicken wird 1709 von der Pest heimgesucht und die größte Zahl der Höfe werden verlassen und veröden
- Von ersten litauischen Neuansiedlern wird 1713 in Uszupönen einem Nachbarsort von Willschicken berichtet
- Das Umland von Wilpischen wird 1721 vermessen
- Das 1735 gegründete Hauptamt „Littauische Kriegs- und Domänen-Kammer zu Gumbinnen“ besteht bis 1808
- In der Liste der Königl. Domänenamtsmänner in Preussisch-Littauen wird Amtmann Chr. Theodor Praetorius 1735 für das Amt Lappönen aufgeführt
- 1736 wird Klein Aulowönen als Koloniedorf von 11 eingewanderten Salzburger Kolonisten-Familien genannt
- Nach dem 1. Juli 1757 besetzt die Zarenarmee Ostpreußen und wurde von Friedrich II. (dem Großen) bis 1763 wieder vertrieben
- Mit der Friderizianischen Kolonisation von 1763 – 1775 wurden im Rahmen des Landesausbaues neue Siedlungsgebiete festgelegt
- Im Jahre 1785 hat sich Wilschicken zu einem Chatouldorf mit 15 Feuerstellen (Wohngebäuden) entwickelt.
- Ein- und Ausfuhren in und von Königsberg 1797 - 1802
- Ab 1806 kommt es in Willschicken zur Zwangsabgabe von Lebensmitteln und Vieh an die durchziehende französische Armee.
- Vorlauf und Durchführung der Preußischen Reformen von 1807 bis 1815
- Das Chatouldorf Willschicken hat im Jahre 1815 aufgrund der Napoleonischen Kriege nur noch 4 Feuerstellen mit 85 Bewohnern
- Die Bevölkerung in Willschicken verdoppelt sich von 85 im Jahr 1823 auf 168 Einwohner im Jahr 1869
- Nach der Reichgründung schrumpfen aber die Willschicker wieder langfristig von 164 im Jahre 1871 auf 122 gemeldete Einwohner im Jahre 1933
- Berta und Ferdinand Tuttlies heiraten 1904 in Willschicken
- Ferdinand Tuttlies nimmt 1914 am 1. Weltkrieg teil
- Der verlorenen 1. Weltkrieg hatte für Deutschland und Ostpreußen ab 1919 u.a. sowohl finanzielle als auch räumliche Folgen
- Nach dem Ende der Weimarer Republik verkündet der Bürgermeister von Willschicken 1933: Willschicken soll nationalsozialistisch werden
- Am 03. 06. 1938 Umbenennung der Gemeinden Willschicken in Wilkental
- Von den 122 Einwohnern in Wilkental im Jahre 1939 kamen durch den 2. Weltkrieg und dessen Folgen 34 Menschen um, darunter 4 Mitglieder der Tuttliesen Familie.
Dorfentwicklung von Wilpische / Willschicken / Wilkental
Willschicken (1938 umbenannt in Wilkental) wurde etwa um 1785 als Schatulldorf zuerst erwähnt. Es hatte schon eine gemeinsame Pferdetränke und einen Friedhof [3] (siehe auch den separaten Bericht: „Ländliche Entwicklung in Ostpreußen am Beispiel des Dorfes Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.)" und die Schroetterkarte (1796-1802). Die Umgegend von Wilpischen wurde als Siedlungsplatz schon 1657 zum ersten Male erwähnt. Es durchlief verschiedene Entwicklungsphasen, blieb aber immer ein überschaubares kleines Bauerndorf. Im Jahre 1947 wurde Willschicken als Siedlung nach der Vertreibung der letzten 4 zurückgekehrten deutschen Bewohner endgültig aufgelöst. Es bestand 290 Jahre. Das ehemalige Siedlungsgebiet von Willschicken gehört seit 1945 zum russischen Oblast Kaliningrad. Die Fläche der (teil) aufgelassenen Dörfer Wilkental und Alt Lappönen und wurde nach 1945 der weiter bestehenden Gemeinde Kalinowka (russisch Калиновка, deutsch Aulowönen) bzw. Lindenhöhe zu Kaluschskoje (russisch Калужское, deutsch Grünheide) zugeschlagen.
Zur Dorf- beziehungsweise Landesgeschichte siehe: Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)
Politische Einteilung
Zugehörigkeit

Provinz : Ostpreußen
Regierungsbezirk : Gumbinnen
Landkreis : Insterburg
Amtsbezirk : Groß Franzdorf
Gemeinde : Wilkental
Kirchspiel : Aulenbach (Ostp.)
im/in : südlich des Flusses Ossa
bei : ca. 22 km nördlich von Insterburg, 3,2 km östlich von Aulowönen
Weitere Informationen
Orts-ID Willschicken : 62435
Fremdsprachliche Ortsbezeichnung : - - -
Fremdsprachliche Ortsbezeichnung (Lautschrift):
russischer Name : - - -
Kreiszugehörigkeit nach 1945 : - - -
Bemerkungen aus der Zeit nach 1945 : Der Siedlungsplatz existiert nicht mehr
weitere Hinweise :
Staatszugehörigkeit : Russisch
Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen (2005)
Kirchliche Einteilung / Zugehörigkeit
Evangelische Kirche
Der Ort Willschicken (Wilkental) gehört zum Kirchspiel Aulowönen, die evangelische Kirche befand sich in Aulowönen. Das Kirchspiel war überwiegen, auch bedingt durch die Migration der Salzburger um 1732 evangelisch. Siehe: Kirchspiel Aulenbach (Ostp.)

Die hierarchische Unterstellung stellt sich wie folgt dar: Evangelische Kirche Aulenbach --> Kirchspiel Aulowöhnen --> Kirchenkreis Insterburg --> Kirchenprovinz Ostpreußen --> Kirchenbund Evangelische Kirche der altpreußischen Union.
Kirchenbuchbestände existieren und können - jedoch gebührenpflichtig - bei www.ancestry.de unter Gross Aulowönen online eingesehen werden. Sie sind jedoch nicht immer vollständig.
- Heiraten und Tote 1737-1839
- Heiraten und Tote 1766-1866
- Taufen 1736-1775
- Taufen 1809-1817
- Taufen 1818-1839
- Taufen, Heiraten und Tote 1604-1860
- Taufen, Heirate, Tote und Index 1788-1808
Außerdem befinden sich einige Kirchenbuchunterlagen, verfilmt auf Microfiche im Sächsischen Staatsarchiv, Staatsarchiv Leibzig, hierbei handelt es sich um die Bestände der ehemaligen Deutschen Zentralstelle für Genealogie (DZfG).
Katholische Kirchen
Eine katholische Kirche existierte nur in Insterburg (Ostp.). Die hierarchische Unterstellung stellt sich wie folgt dar: Landgemeinde Aulowönen --> Kirchspiel Insterburg --> Katholische Kirchengemeinde Insterburg --> Dekanate Tilsit --> Katholische Kirche in Ostpreußen.
Über den Verbleib von Kirchenbüchern liegen keine Informationen vor.
Neuapostolische Kirche
In Aulowönen gab es einen Betsaal der Neuapostolischen Kirche. Die Gemeinderäume befanden sich in Haus der Familie Herzigkeit Die hierarchische Unterstellung stellt sich wie folgt dar: Bezirk Tilsit --> Apostelbezirk Königsberg (Ostp.)
Amtliche Zählungen / Zensus von Willschicken
Die folgenden Angaben gehen zurück auf: Der Landkreis Insterburg Ostpreußen - ein Ortsnamen-Lexikon. Mit geschichtlichen Daten, Namen, Zahlen und Begebenheiten, aus mehr als 600 Jahren. Karl und Charlotte Hennig Verlag: Privatdruck, Grasdorf-Laatzen, wahrscheinlich 1981 [6]
Ortsgrundfläche
- 1905/1925 : Gemeindegröße 319,8 ha, Grundsteuer Reinertrag 8,87 je ha,
Wohngebäude
Amtlich gezählt :
- 20 (1871)
- 28 (1905)
- 25 (1925)
Haushalte
- 30 (1871)
- 32 (1905)
- 31 (1925)
Einwohner
- 85 (1700)
- 85 (1815)
- 85 (1823)
- 110 (1853)
- 155 (1858)
- 127 (1865)
- 134 (1867)
- 154 (1871)
- 166 (1885)
- 150 (1905) davon männlich 75
- 146 (1925) davon männlich 66
- 127 (1933) davon männlich 52
1871 sind alle Einwohner preußisch und evangelisch, 68 ortsgebürtig, 37 unter 10 Jahre, 73 können lesen und schreiben, 44 Analphabethen, 5 ortsabwesend; 1905 139 evangelisch, 11 andere Christen, 131 geben Deutsch als Muttersprache an, 15 litauisch, 4 Deutsch und eine andere. 1925 alle evangelisch
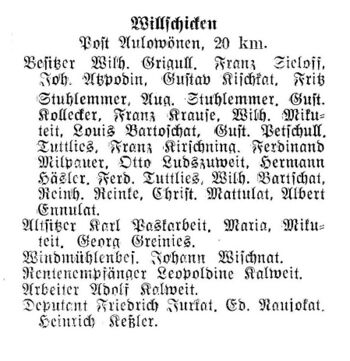
Folgende Einwohner sind im Ortschafts- und Adreßverzeichnis des Landkreises Insterburg (1927) unter Willschicken, Post Aulowönen genannt [3]
- Besitzer : Wilhelm Grigull, Franz Sieloff, Johann Aßpodin, Gustav Kirchsat, Fritz Stuhlemmer, August Stuhlemmer, Gustav Kollecker, Franz Krause, Wilhelm, Mikuleit, Louis Bartoschat, Gustav Petschull, Ewald Tuttlies, Franz Kirschning, Ferdinand Milpauer, Otto Ludszuweit, Hermann Häsler, Ferdinand Tuttlies, Wilhelm Bartschat, Reinhard, Reinke, Christian Mattulat, Albert Ennulat
- Altsitzer : Karl Pastarbeit, Maria Mitukeit, Georg Greinies,
- Windmühlbesitzer : Johann Mischnat,
- Rentenempfänger: Leopoldine Kalweit
- Arbeiter : Adolf Kalweit,
- Depudant : Friedrich Jurkat, Eduard Naujokat, Heinrich Keßler.
Zahl und Größe der landwirtschaftlichen Betriebe
- 5 zwischen 0,5-5 ha
- 6 zwischen 05-10 ha
- 6 zwischen 10-20 ha
- 5 zwischen 20-100 ha
Wirtschaft
Landwirtschaftliche Güter in Willschicken
In Niekammer’s landwirtschaftliche Güter-Adreßbücher, (Band III) 1922 Seite 130/131 [4] wird folgendes Gut angegeben:
Willschicken: Gut Nr. 12 zur Gemeinde Willschicken gehören , Aulowöhnen Post, Telegraph, Standesamt Grünheide Eisenbahn, Groß Warkau Amtsbezirk, Insterburg Amtsgericht,
- Wilhelm Grigull: Grundsteuerreinertrag in (Reichs)Mark : 474,--; 60 ha, davon 46,5 Acker incl. Gärten, 10 Weiden, 3 Unland/Hof/Wege, 0,5 Wasser, 9 Pferde, 24 Rinder, davon 11 Kühe, 3 Schafe, 12 Schweine;
In Niekammer’s landwirtschaftliche Güter-Adreßbücher, (Band III) 1932 Seite 167 [5] werden folgende Güter angegeben:
Willschicken: Güter Nr. 12 und 13 zur Gemeinde Willschicken gehören, Aulowönen Post, Telegraph Grünheide Eisenbahn 5 km
- Abbau Wilhelm Grigull: 60 ha, davon 42 Acker, 15 Weiden, 2,5 Unland/Höfe/Wege, 0,5 Wasser, 10 Pferde, 30 Rinder, davon 12 Kühe, 3 Schafe, 12 Schweine; Telefon: 64
- Abbau Sieloff: 43 ha, davon 30 Acker, 2 Wiesen, 10 Weiden, 1 Unland/Höfe/Wege, 8 Pferde, 24 Rinder, davon 10 Kühe, 10 Schweine; Telefon: 67
Schadensberechnung
Die Tabellen "Schadensberechnung Landwirtschaft" wurden zum Zweck eines möglichen Lastenausgleiches von der Bundesrepublik 1955 auf Grund der fortgeschriebenen Datenlage von 1945 als Erhebungspunkt erstellt. Die Daten beruhen aber durchweg auf den real erhobenen vorläufigen Ergebnissen der Volkszählung vom 17. Mai 1939. Bäuerliche Landverkäufe waren nach dem Preußischen Erbhofgesetz von 15.5.1933 in Ostpreußen nicht mehr möglich.
Der Gemeindehektarsatz beträgt 1933 in Willschicken errechnet 650,-- Reichsmark, der Durchschnitt der Betriebshektarsätze : 325,-- ha. Die Gemeindefläche der Gemeinde umfasst 320 ha. Zur Berechnung der Gemeinhektarsätze siehe Kap. 3.2.27 in Ländliche Entwicklung von Ostpreußen.
Die Schadensberechnung Landwirtschaft Betriebsliste Gemeinde Wilkental Kreis Insterburg, Bez. Gumbinnen (Stand 1945 - erstellt 1955) nennt folgende landwirtschaftliche Betriebe:
- A1. Ludzuweit, Otto und Ehefrau, 3,49 ha
- B1. Allissat, August, -,-- ha + 5,00 ha (Zugepachtet)
- 2. Bartschat, Wilhelm, 25,00 ha / - 25,00 ha (Verpachtet)
- 3. Dingel, Artur, -,-- ha + 15,75 ha (Zugepachtet)
- 4. Ennulat, Kurt, 12,00 ha
- 5. Grigull, Ernst, 66,66 ha, Güter Nr. 60
- 6. Haesler, Herman, 6,50 ha
- 7. Kollecker, Gustav und Ehefrau, 11,27 ha
- 8. Kornberger, August, 26,75 ha
- 9. Mattulat, Paul, 25,82 ha
- 10. Mikuteit, Wilhelm, 15,75 ha
- 11. Milpauer, Albert, 8,75 ha
- 12. Papendick, Friedrich -,-- ha / + 6,50 ha (Zugepachtet)
- 13. Petschull, Gustav, 4,00 ha
- 14. Reinke, Reinhold, 5,00 ha
- 15. Sieloff, Franz, 43,48 ha, Güter Nr. 43
- 16. Stuhlemmer, Fritz und Ehefrau, 16,50 ha
- 17. Tuttlies, Ewald, 7,00 ha / - 7,00 ha (Verpachtet)
- 12. Tuttlies, Erich, 6,00 ha
- Bisher nicht angemeldete Betriebe :
- 19. Bartoschat, Auguste, 10,25 ha
- 20. Kirschning, Franz, 4,50 ha / - 4,50 ha (Verpachtet)
- 21. Krause, Leopoldine, 21,25 ha
- 22. Nolde, Kurt, 11,00 ha
Höfe - Besitzer und Beschreibungen
Höfeverzeichnis
Die folgende Tabelle zeigt die Betriebsgrößen der Höfe in Willschicken in ha. Die Zuschreibungen Großbauer, Gutsbesitzer, Besitzer, Arbeiter und Meier stammen aus den Quellen Niekammers Güteradressbuch 1932, sowie Kurt und Charlotte Henning: Der Landkreis Insterburg, Ostpreußen. Ein Ortsnamen-Lexikon. Großbauern sind dort mit (*) gekennzeichnet.
Sie gehen vermutlich auf amtliche Steuerlisten aus den Jahren 1910 und 1920 zurück.

Hofbesitzer in Willschicken, Stand: ca. 1934 [11]
- 1: Hof Kollecker, Gustav: Besitzer, 11,27 ha
- 2: Hof Allissat, August: Besitzer, 5,00 ha, gepachtet von Reinke
- 3: Gut Sieloff, Franz: Gutsbesitzer, 43,48 ha
- 4: Hof Pukris: Molkerei (Molkereibesitzer),
- 5: Hof Dingel, Artur: Besitzer, 15,75 ha, gepachtet von Mikuleit
- 6: Hof Stuhlemmer, Fritz: Besitzer, 16,50 ha
- 7: Hof -unbekannt-
- 8: Hof Nolde, Kurt: Besitzer, 11,00 ha
- 9: Hof Bartschat, Wilhelm (*): Großbauer, 25,00 ha, verpachtet an M. Bartoschat
- 10: Hof Milpauer, Albert (*): Großbauer, 8,75 ha
- 11: Hof Mikuteit, Wilhelm (*): Großbauer, Bürgermeister bis 1940, 15,75 ha verpachtet an Dingel
- zwischen 10 und 11: Bürgermeister Stube (Gebäude auf der anderen Straßenseite mit Scheune)
- 12: Hof Krause, Leopoldine (*): Großbauer, 21,25 ha
- 13: Hof Kirschning, Franz (*): Großbauer, verpachtet 4,50 ha
- 14: Hof Kornberger, August (*): Großbauer, 26,75, ha
- 15: Hof Bartoschat, Auguste (*): Großbauer, 10,25 ha + 25,00 ha Pacht
- 16: Hof Mattulat, Paul (*): Großbauer, 25,82 ha
- 17: Gut Grigull, Ernst: Gutsbesitzer, 60,66 ha
- 18: Hof Häßler, Hermann und Frau Bartschs: Besitzer, Nähe Friedhof 6,50 ha
- 19: Windmühle und Hof Pettschull: Besitzer, 4,00 ha
- 20: Hof Papendieck, Friedrich und Frau Flemig: Arbeiter in Ewald Tuttliesens Landarbeiterhaus, 7,0 ha Pacht
- 21: Hof Tuttlies, Ewald: Besitzer, 7,0 ha, - 7,0 ha, verpachtet an Papendick
- 22: Hof Ludzuweit, Otto: Besitzer, 3,49 ha
- 23: Hof Ennulat, Kurt: Besitzer, 12,00 ha
- 24: Hof Tuttlies, Erich: Besitzer, Maurer, Schneider, 6,00 ha
- 25: Hof Reinke, Reinhold: Besitzer, verpachtet an Allissat 5,00 ha
Die Ge- und Verpachtungen geschahen häufig innerhalb der Gemeindegrenzen. Es gab aber auch Fällten, dass die Akteure nicht in Willschicken wohnten. Anlass der der Verpachtungen waren in der Regel finanzielle Hintergründe, wie Hofaufgabe, Altersversorgung und Schuldenanhäufung. Gepachtet wurde bei sinnvollen Grundstücksarrondierungen und erfolgsversprechenden wirtschaftlichen Perspektiven.

Der Hof von Ewald Tuttlies war hoch verschuldet und wurde aus formalen Gründen von Herrn Papendick und Frau Flemig gepachtet, die Hofbewirtschaftung geschah jedoch durch Ferdinand bzw. Erich Tuttlies. Siehe dazu in Ländliche Entwicklung von Ostpreußen die Kapitel 6.2 Verschuldung und 8.11 Entschuldung.
1939 bildeten nur noch 7 Großbauern von insgesamt 23 Höfe den alten historischen Dorfkern von Wilkental. (obigen Tabelle mit (*) markiert).
Dazu kam noch die Windmühle von Pettschull und die Bürgermeisterstuben von Mikuteit.
Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Wilkental betrug 1939: 8 zwischen 5-10 ha, 5 zwischen 10-20 ha und 10 zwischen 20-100 ha.
Die Besitzverhältnisse hatten sich umgedreht. Von den 319,8 ha die Gesamtfläche der Gemeinde Wilkental in den Grenzen 1882 ausmachte, besaßen die Großbauern 1939 zusammen nur noch 83 ha, die Neusiedler dagegen kamen zusammen auf 236,8 ha.
Um 1880 besaß noch jeder der 7 Großbauern in Wilkental durchschnittlich ca. 40 ha. Land.
Die Höfe und Ihre Bewohner - Familie Tuttlies
Familienstammbaum Tuttlies
Willschicken war die Heimat von Berta und Ferdinand Tuttlies. Das Ehepaar Tuttlies hatte 5 Kinder: Max, Erich, Otto, Friedel und Hildegard.
Die Familiennamen waren, gerade auch in den älteren Unterlagen, häufig mit unterschiedlicher Schreibweise zu finden. Es gab noch keine amtlich festgelegte Schreibweise der Personennamen. Zudem wurden die Namen im weitgehend analphabetischen ländlichen Bereich mündlich gebraucht und dabei laufend verändert. Der Amtsschreiber hat den Namen dann so geschrieben, wie er ihn akustisch verstanden hatte und wie er das Gehörte in Buchstaben umsetzen konnte. Zum Gedenken an das Ende der Befreiungskriege wurde am 4. Juni 1816 in der Kirche in der Nachbargemeinde Aulowönen eine Totenfeier für die in den Feldzügen 1813 -1815 gefallenen 28 Gemeindemitgliedern abgehalten. Unter der Ziffer 15. war zu lesen: " Johann Tutlys, Kürassier des Ostr. Rgt., Sohn des Wirthen David Tutlys aus Klein Popelken (Kirchspiel Aulowönen), er starb einen ehrenvollen Tod in der Schlacht bei Leipzig mit 23 Jahren."
Die von Gerhard und Hildegard Kiehl - geb. Tuttlies - auffindbaren Daten der Kirchenbücher und der Mühlenlisten zeigen für die männliche Linie der Tuttliesen in Willschicken folgende Einträge:
„Stammbaum von Michael Tuttlys“
- Michael Tuttlys, Losmann, *1802, in Treinlauken/Kreuzberg, †25.3.1842 in Ernstwalde, ∞23.10.1830 in Treinlauken Charlotte Schoentaube, *03.01.1806 in Spannegeln,
- Kind von 1: Johann Ferdinand Tuttlies, Bauer und Maurermeister, *11.07.1833 in Treinlaucken/Kreuzberg, †13.10.1923 in Willschicken, ∞10.11.1865 in Staggen Maria Mauscherning, *02.06.1836, †15.03.1901 in Willschicken
- Kind von 2: August Herrmann Tuttlies Besitzer, *1866 in Willschicken, †1921 in Willschicken
- Kind von 3: Ewald Tuttlies, Besitzer, *1886 in Willschicken
- Kind von 3: Ferdinand Tuttlies, Besitzer, Maurer, Schneider, *01.12.1869 in Plattupönen, †01.08.1949 in Vethem ∞14.11. 1902 Berta Tuttlies, geb. Burba, *31.08.1883 in Paduken, †03.07.1968 in Hamburg
- Kind von 5: Max Tuttlies, Kaufmann, *19.01.1903 in Paducken, †13.01.1964 in Krostiz, ∞ Gertrud, geb. Heinrichs, *26.07.1908 in Jennen, †28.01.1982 in Jesingen
- Kind von 5: Friedel Tuttlies, Hausmeisterin, *25.10. 1910 in Willschicken, †03.12.1993 in Oberweißbach, ∞Helmuth Harward, *05.05.1906, †gef. 1944
- Kind von 5: Erich Tuttlies, Besitzer, Maurer, *19.11.1905 in Willschicken, †12.04.1995 Südkampen, ∞Erna … , *06.07.1924, †20.07.2017 Südkampen
- Kind von 5: Otto Tuttlies, *1909 in Willschicken, †31.12.1913 in Willschicken, ist schon mit 4 Jahren verstorben
- Kind von 5: Hildegard Kiehl, Angestellte, *21.03.1920 in Willschicken, †19.06.2021 in Hamburg ∞Gerhard Kiehl, *04.08.1914 in Pillwogallen, †09.09.1998 in Hamburg
Schon vor der Reichsgründung tauchte der Name Tuttlies in Willschicken auf. Nachfahren der Familie Tuttlies waren sehr aktiv in der Ahnenforschung und es gibt zahlreiche Veröffentlichungen zu den Familien Podewski, Tuttlies und Kiehl; hierzu :
- Die Nachkommen Padeffke und Podewski des Peter Paquadowski
- Stammdaten der Familie Podewski
- Vorfahren von Hildegard TUTTLIES
- Vorfahren von Gerhard KIEHL
Direkt in Aulowönen war ein weiteres Mitglied der Tuttliesen, nämlich Johann Ferdinand Tuttlies zu Hause. Er besaß einen Bauernhof und ein Baugeschäft. Er hat als Maurermeister seinen Enkel Ferdinand Tuttlies noch persönlich zum Maurer ausgebildet. Ebenfalls hat in diesem Baugeschäft, nach dem Tod von Johann Ferdinand Tuttlies , der Ur-Enkel Erich Tuttlies eine Maurerlehre absolviert. Johann Ferdinand Tuttlies der Großvater von Ferdinand Tuttlies wurde 11.07.1833 in Treinlaucken/Kreuzberg geboren. Er heiratet am 10.11.1865 in Staggen im Kirchspiel Aulowönen Maria Mauscherning. Er hat im Kirchspiel Aulowönen in Willschicken, während der Getreidekonjunktur 1848-1873, um 1860 als Maurer Arbeit gefunden und eine Bauernstelle als Besitzer mit Wohnhaus einrichten können. Danach hatte er ein Baugeschäft in Aulowönen. Er hat relativ spät geheiratet und ist dann auch in Willschicken 1901 gestorben. Seine 5 Söhne und sein 8 Enkel wuchsen dann ebenfalls in Willschicken auf. Von ihnen blieben nur 2 Söhne und 3 Enkel in Willschicken und der weiteren Umgebung.
Ferdinand Tuttlies ist am 01.12.1869 in Plattupönen, dem Nachbar-Wohnort seiner Ur-Großeltern geboren worden - hier gab es eine verwandte Hebamme - ist dann aber noch als Kleinkind nach Willschicken zurückgekehrt. Das frühere Dorf Plattupönen gehörte zwischen 1874 und 1945 zum Amtsbezirk Schaltischledimmen (1929 bis 1947: Neuwiese, heute russisch: Nowoselskoje). Dieser wurde 1930 in „Amtsbezirk Neuwiese“ umbenannt und war Teil des Kreises Labiau im Regierungsbezirk Königsberg der preußischen Provinz Ostpreußen. Im Jahr 1938 wurde Plattupönen in „Breitflur“ umbenannt.
Zum regionalen Tuttliesen-Clan im Kirchspiel Aulowönen gehörten wie berichtet, neben die Höfe von Ferdinand und Ewald Tuttlies, auch die Anwesen von Papendieck (mit 6,50 ha Pachtland) und Ludzuweit früher Weinowski (mit 3,49 ha) - beide eingeheiratet - in Willschicken und zwei weitere Höfe in Aulowönen und Alt Lappönen - Tuttlies und Jägu (siehe Karte Lappönen Neusiedler). Hinzu kamen weitere persönlich unbekannte Verwandte aus dem Kirchspiel Aulowönen in den Gemeinden Klein Popelken, Staggen und Aulowönen selbst. Diese wurden in Gesprächen in Willschicken zwar erwähnt, aber nach der Erinnerung von Hildegard Tuttlies nie besucht.
Die erhebliche kürzere Lebenserwartung und Anzahl der überlebenden Kinder spielte im Leben der Familien auf dem Lande eine große Rolle. Im Deutschen Reich betrug 1871/1881 die durchschnittliche Lebenserwartung, wie schon berichtet, bei Geburt für Jungen 35,6 Jahre und für Mädchen 38,4 Jahre. Um 1900 lag die Fruchtbarkeitsziffer für Frauen bei 4,93 Kinder. Sieht man sich den Stammbaum der Tuttliesen an, trifft das nicht für alle Familienmitglieder zu. 1871/1881 wurden in jedem Haushalt im Deutschen Reich durchschnittlich 5,8 Kinder älter als 5 Jahre. Diese trifft für die Tuttliesen überwiegend zu.
Nach der Bauernbefreiung in Preußen hatte beispielsweise die Hälfte der auf dem Land Lebenden keinen Grundbesitz mehr und musste sich anderen Erwerbsquellen zuwenden, sich in der Landarbeit verdingen oder abwandern. Das galt besonders auch noch später für überwiegende Zahl der aufwachsenden Kinder auf dem Lande. Dieses trifft auch auf die Familien Ferdinand Tuttlies zu. Max, Friedel, Erich und Hildegard Tuttlies verließen (zeitweise) ihr Zuhause.
Hausbau in Willschicken



Mutter Berta Tuttlies bekam zur Hochzeit 1902 als Mitgift 16 ha Land von ihrem Elternhaus - den Burbas aus Paducken – einer Nachbargemeinde. Das Land war nicht vollständig landwirtschaftlich nutzbar. 10 Hektar konnten u.a. an die Kleinbahn verkauft werden, um den Hausneubau mitzufinanzieren. Dazu kam ein günstiger Kredit in Höhe von 25 % der Baukosten von der Ostpreußische Generallandschaftsdirektion, der für "Aussiedlern" von Erbhöfen möglich war.
Vater Ferdinand Tuttlies war Besitzer und Handwerker zugleich, er war zusätzlich als gelernter Maurer und als angelernter Schneider tätig. Ein kleiner Landteil wurde für den Hofbau als Grundfläche benötigt. Er lag direkt an der Chaussee in Willschicken. Dieses Landteil erhielt Ferdinand Tuttlies von seinen Willschicker Eltern ebenfalls zur Hochzeit.
Zunächst mussten die Baugenehmigung erteilt werden. Dabei waren der örtliche Bebauungsplan und das preußische Fluchtliniengesetz zu berücksichtigen.
Im Jahre 1904 machte sich Ferdinand Tuttlies unterhalb der Lindenhöher - Alt Lappöner Chaussee auf Willschicker Gemeindeland an den Bau eines eigenen Hofes. Die junge Familie suchte ein eigenes Zuhause. Auf der anderen Straßenseite lag in Willschicken sein Elternhaus. Im Elternhaus wohnte der Besitzer August Herrmann Tuttlies, geboren 1866. Nach dessen Tod 1921 übernahm es dessen 2. Sohn Ewald Tuttlies.
Am 15. Oktober 1923 wurde in Berlin zur Neuordnung der Währungsverhältnisse in Deutschland die Deutsche Rentenbank errichtet. Ihre Aufgabe bestand in der Stabilisierung der Währung und der Rückgewinnung des völlig verlorengegangenen Vertrauens in das deutsche Geld. Damit gelang es, die Hyperinflation abrupt anzuhalten. Die alte Mark blieb vorerst gesetzliches Zahlungsmittel und wurde am 30. August 1924 durch die Reichsmark ersetzt. Wer sich etwa vor 1921 für ein Haus oder anderen Grundbesitz verschuldet hatte, der war über Nacht seine Schulden los. Größter Profiteur war der Staat. Seine gesamten Kriegsschulden in Höhe von 154 Milliarden Mark beliefen sich, als am 15. November 1923 die neue Währung Rentenmark eingeführt wurde, auf die Buchungsposition von 15,4 Pfennige.
Das neue Anwesen von Ferdinand Tuttlies war ab 1923 schuldenfrei. Der 1904 aufgenommene Kredit in Höhe von 25 % der Baukosten von der Ostpreußische Generallandschaftsdirektion musste nicht mehr ganz zurückgezahlt werden.
Beim Hofbau 1904 halfen Verwandte und Bekannte mit. Die Talka „Bitthilfe“ bezeichnete in Preußisch-Litauen die gegenseitige unentgeltliche Gemeinschaftsarbeit unter den Dorfbewohnern, die bei umfangreichen landwirtschaftlichen Arbeiten wie Pflügen, Aussaat, Roggenernte, Dreschen und Hausbau erbeten und gewährt wurde. Verwandte und Dorfbewohner halfen, wie damals üblich, mit. Die „Bau-Talka“ (lit. pastatyti talką) galt allgemein als bedeutende Veranstaltung im Vergleich etwa zu den weniger Personen einbeziehenden Mäh-, Dresch- und Schlacht-Talkas. Einigen Berichten zufolge war sie allerdings noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Gegend von Pillkallen eine Angelegenheit des ganzen Dorfes. Oft schloss ein großes abendliches Fest – möglichst mit Musik und Tanz – eine Talka ab, immer war sie mit reichlicher Verköstigung der Helfer verbunden.
Bei der Bau-Talka wurde in der Regel hauptsächlich am Wochenende gearbeitet. Dies erklärt auch die lange Bauzeit auf dem Tuttliesen Hof.
Hof Tuttlies - eine Beschreibung
So entstanden für die junge Familie von Ferdinand Tuttlies und Berta Burba ein stabiles eineinhalbgeschossig Wohnhaus. Es war ganz aus Ziegel aufgemauert hatten hellen Außenputz und war mit roten Dachpfannen bedeckt. Besonderes Augenmerk wurde auf einen feuerfesten Kamin gelegt. Das Wohnhaus wurde beheizt durch einen großen Kachelofen, der seine Wärme über ein Warmluft-Kanalsystem auch im Obergeschoss verteilte, den Küchenherd und im Winter auch durch die Außenwand der eingebauten Räucherkammer. Dazu kamen im Winter in den Schlafzimmern kleine "Stöfkes". Das raue Klima mit seinen durchschnittlichen 173 Frosttagen im Jahr beschränkte die Vegetationszeit auf sechs bis sieben Monate und stellte die Landwirtschaft in Ostpreußen vor große Probleme. Die Heizungsperiode betrug im Durchschnitt sieben Monate. Die Häuser erforderten dickere Mauern, stabile Dächer und Doppelfenster. Im Winter war in Ostpreußen der Pelz eine normale Arbeitskleidung. Großen Schaden nahmen die Obstpflanzungen während des sehr strengen Winters 1928/29. Bis zu 75 % der Obstbäume fielen dem sehr strengen Frost von über 30 Grad Celsius zum Opfer. Bei den Tuttliesen mussten alle Obstbäume neu gepflanzt werden
- Der Hof von Ferdinand Tuttlies
Beladen der neuen Scheune auf dem Hof von Familie Tuttlies vor dem geöffneten Hoftor 1906 [18]
Innenhof der neue Bauerstelle Tuttlies. Scheune, Hoftor und Stall, 1910 [19]
Der Tuttliesen Hof aus der Ferne. Im Vordergrund Hildegard Tuttlies mit ihrer Lieblingskuh "Lisa". 1930 [20]
Vier- oder Dreikant war die vorherrschende Bauform der Höfe in Preußisch-Litauen. Die "neuen" Wohnhäuser der Bauern, zumindest im Willschicken, waren in der Regel eineinhalbgeschossig aufgemauert, außen hell verputzt , häufig mit einem Zierband aus roten Ziegeln oder weißen Aufputz um Außentüren, Fenster und am Giebel versehen und mit roten Dachpfannen gedeckt. Stroh- und Reetdächer waren wegen Feuergefährlichkeit untersagt. Die Fundamente mussten fachgerecht aufgemauert und auf Feldsteinen gelagert werden. Die Fundamentoberkanten mussten 20 bis 40 cm. über dem Erdboden liegen. Ställe, Scheunen und Nebengebäude wurden in Fachwerk mit einem Feldsteine-Unterbau und zum Teil mit einer äußern Holzverschalung ausgeführt. Die tragenden Bauhölzer der Gebäuden mussten mit stark riechendem Karbolineum gegen Fäulnis gesichert werden. Die Ziegel kamen aus Aulenbach von der Ziegelei Teufel oder der Ziegelei Guddadt. Feldsteine, Holz und Lehm gaben das eigene Land oder das der Nachbaren in Willschicken her. Keller waren bei kleinen Höfen unüblich. Größere Höfe und Gaststätten besaßen häufig einen "Eis-Keller" der im Winter mit Natureis gefüllt wurden und - je nach Klima - bis zum Hochsommer vorhielt. Der Dachboden "de Lucht" war ein sehr beliebter Kinderspielplatz.
Gegenüber dem Wohnhaus lag die zweistöckige Scheune mit aufgemauerten Giebeln. Die Zufahrt war rechtwinkelig von der Straße zu der hinteren Hofseite angelegt. Sie war auch gepflastert und führte außen am Scheunengebäude vorbei. So konnte die Scheune von beiden Seiten "beladen" werden. Im rechten Winkel lag dazu das ebenfalls eineinhalbgeschossiges, mit Holz verschalte Stallgebäude. Auf der Hinterseite der Ställe gab es mit einem Schweinegarten und einem Rossgarten. Ein Anbau mit Geflügel- und Ziegenstall schloss den Vierkant ab.
Der innere Hof war zum Teil mit behauenen Feldsteinen ausgepflastert. Der Hof maß etwa 15 x 15 Meter, so dass eine bespannte Feuerwehrspritze darin wenden konnte. Zwischen den Höfen musste der Feuerabstand mindestens 150 Fuß etwa 42 Meter betragen. Zur Straßenseite gab es einen Ziergarten und hinter dem Wohnhaus einen Gemüse- und Obstgarten mit 24 Obst-Bäumen. Darin gab es eine Fliederlaube, ein herrliches Versteck für die Kinder. Der Hof war außen mit einem Staketenzaum umfriedet und wurde außen zum Windschutz mit Bäumen und Hecken umpflanzt. Er wurde durch ein großes Tor verschlossen und vom Hofhund Lux bewacht. Es war ein kleiner Vierkanthof entstanden. Die Baumaterialien waren Ziegel, Feldsteine, Lehm und Holz. Es hat bis 1906 gedauert, bis alles fertig war. Diese Annahme lässt sich aus dem Messtischblatt 1197 (Grünheide) Bereich Willschicken von 1934 ableiten. unten rechts. Die Vermessung muss vor 1906 entstanden sein, da sie nicht den endgültigen Ausbau des Tuttliesen-Hofes zeigt.
Geschichten & Anekdoten rund um Willschicken
Dorfleben in Willschicken / Wilkental
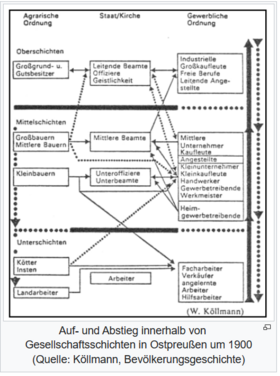
In Wilkental gab es 1939 das ehrenamtliche Bürgermeisteramt (Gemeindevorsteher), eine kleine Molkerei und einen Friedhof, aber es gab keinen Laden, keine Schule, keine Kirche und keine Gaststätte. Scherenschleifen, Zwiebelbauern, Heringshändler und Petroleums-Verkäufen zogen zu bestimmten Zeiten durch das Dorf, dazu kamen Vieh- und Pferdehändler und Heimatlose. Die Post kam zweimal die Woche. Seit 1825 war es gestattet, Land-, Fuß-Boten oder Briefträger einzustellen. Sie stellten zwei- bis dreimal in der Woche Briefe, Adressen, Zeitungen und Amtsblätter gegen ein Bestellgeld in der Umgegend des Postbezirks zu und nahmen, wieder gegen ein Bestellgeld, solche Sendungen an. Die Landbriefträger wurden von der Postanstalt unter Vertrag genommen und besoldet, das Bestellgeld floss in die Postkasse und sollte die Kosten für diese Dienstleistung decken. Diese Reglungen blieben bis zur Weimarer Verfassung bestehen.
Dörfer wie Wilkental hatten zu jener Zeit funktionierende soziale Netze von Hilfe, Zurückhaltung und Ausgrenzung (siehe dazu: Pierre Bourdieu, Der feine Unterschied). Sie dienten der Sozialkontrollen und zur Abgrenzung zwischen den unterschiedlichen Sozialgruppen im Dorf und der Region. Gutsbesitzer, Bauern und Gesinde grenzen sich sozial gegenseitig ab und heiraten so wie Gutsbesitzer häufig nur untereinander. Allerding war sozialer Aufstieg durch Einheirat in die sozial angesehene Bauerngruppen auch ein gängiges Muster. Gerade auf dem Lande gingen "Eigentumswünsche häufig vor Herzenswünsche". "Wer geht mit wem?" "Hast Du gesehen, dass... " Die Bauern waren ausgestattet mit "feinen" positiven oder negativen Verhaltensregeln den anderen Dörflern gegenüber": "Gode Frind un trie Noawersch send nich mit Gild to betoale", dauerhafte Zuschreibungen: "De ol Grigull" und fixierten Klassenschranken: "Wat du seggst un de Landrat schött, das gölt datselwige" , "Wer nuscht häd, de hoost" , "Tohuus is Tohuus" (siehe: Ostpreußische Sprichwörter, Redewendungen und Weisheiten)
Soziale Rangordnungen wurden schon von den Kindern wahrgenommen. Hildegard Kiehl berichtet von der freiwillig eingenommen Sitzordnung ihrer ersten Konfirmandenstunde: "Vorne saßen kerzengerade die Kinder der Großbauern, dann lümmelten sich die Sprösslinge der mittelprächtigen Bauern und hinten hocken die blassen Kinder der Knechte und Arbeitsleute und ganz hinten verkroch sich der Sohn Micha, sein Vater war im Nebenberuf Abdecker. Man erzählte, dass auf sehr reichen Gütern die feinen Kinder des Gutsherrn vom Pfarrer alleine zu Hause im Haus des Gutshauses über die Religion belehrt wurden - sie sollten wohl von der Dorfjugend nicht verdorben werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das sie aber Privatlehrer hatten, weiß ich von meinem Vater, der schon auf solchen Gütern gemauert hatte".
Das Arbeitsleben auf den Höfen war bestimmt durch Aussaat und Ernte. Ansonsten war das Dorfleben durch christlichen Feiertag, Familienfest und die vier Jahreszeiten geprägt, wobei die langen und strengen Winter eine besondere Rolle spielten. Die Arbeit auf den Höfen richtete sich gewöhnlich nach Aussaat und Ernte nach dem Lebenszyklus von Geburt, Kindheit, Schule, Ausbildung, Armee, Hochzeit, Beruf, Altenteil und Tod. Dabei spielen die erhebliche kürzere Lebenserwartung und Anzahl der überlebenden Kinder eine große Rolle.
In Willschicken wurden die Zeitungen zwar ab 1871 mit der Post (den Gütern) zugestellt, meistens die "Königsberger Hartungsche Zeitung" oder das "Memeler Dampfboot". Sie wurden aber von den Bauern mit einem Tag Verspätung häufig aus Kostengründen in der Gaststätte gelesen. Damals, 1871 waren alle Einwohner preußisch und evangelisch, 68 ortsgebürtig, 37 unter 10 Jahren, 73 konnten lesen und schreiben, 44 Analphabeten.
Die „Ostmarken Rundfunk AG“ später Reichssender Königsberg wurde mit einem 50-Prozent-Anteil der Reichspost am 2. Januar 1924 in Königsberg gegründet. Nicht alle Höfe in Willschicken hatten schon einen Stromanschluss. Während des 2. Weltkrieges kam es in Ostpreußen ab 1941 relativ häufig zu Stromsperren, die manchmal tagelang andauerten. Manche Höfe waren froh, ihre alten Petroleum-Lampen behalten zu haben. Beim Radio musste dann zuerst noch der Akku 4 Stunden lang fremd aufgeladen werden, was aber manchmal „tagelang“ dauerte, da es außerhaus passieren musste. Die Gaststätte Lerdon in Lindenhöhe war eine elektrische "Ladestation" für die Willschicker Bauern. Tuttliesen hörten ab 1934 am Abend zwischen 20 und 21 Uhr eine Stunde Radio Königsberg.

Es gab lange Zeit keine Uhr im Haus Tuttlies. Gerichtet wurde sich nach der Sonne und den Werks-Sirenen der Ziegelei Teufel im nahen Aulowönen: 7:00 in der Frühe und 19:00 am Abend. Bei Tuttlies hieße es: „Wenn de Diwel huult“. Jeden zweiten Sonntag putzte sich die Familie Tuttlies fein heraus und besuchte mit dem Kastenwagen die Kirche in Aulowönen.
Im Stall der Tuttliesen waren 2 Pferde ("Rieke" und "Alexa") 2 Milchkühe ("Lisa" und "Mona"), in der Regel 4 Herdenschweine (zur Eigenbedarf und zum Verkauf) und jährlich 6 bis 8 zugekaufte Ferkel zur Aufzucht und Verkauf, 5 Ziegen (Ziegenbock "Mäck" und Anhang), Hühner und Gänse zu versorgen. Bei den Tuttliesen wurde im Jahr zwei- bis dreimal geschlachtet. Die Pferde wurden häufig gegen Naturalien verliehen, da sie auf dem kleinen Hof nicht ausgelastet waren. Ferdinand Tuttlies sagte: "Wo Duwe sönd, da fleege noch Duwe to." Dazu gaben einen freistehenden echten Taubenschlag und den treuen Hofhund "Lux". Am Stall waren unter der Dachkante zahlreiche Schwalbennester gebaut worden. Trotz Drängen wollte Opa Tuttlies keine Bienenvölker, "De sönd to krabblich".
Die gesamte Familien Tuttlies wurde auf dem Hof gebraucht. Bedarf bestand im Frühjahr bei der Getreideaussaat, beim Setzen von Kartoffeln, Rüben und Wrucken, später beim Behacken derselben, im Juni bei der Heuernte, im Spätsommer bei der Getreideernte und beim Dreschen, im Herbst beim Ernten von Kartoffeln und den anderen Hackfrüchten - dazu kam noch die Gartenarbeit. Beim Getreide musste es der Petkuser Saatroggen sein, gezüchtet von Ferdinand von Lochow (1849 - 1924). Ferdinand Tuttlies sagte dazu "Ferdinandche is good voor us")
Auf den 6 ha des eigenen Landes und den etwa 7 ha des übernommenen Landes vom "bankrotten" Bruders Ewald wurden Roggen und Kartoffeln angebaut, die zur Eigenversorgung und zur Viehfütterung zum Teil eingelagert wurden. Der eingelagerte Roggen war bei sachgemäßer Lagerung bis zu 6 Jahren haltbar, damit konnten Missernten ausgeglichen werden. Außerdem gab es Grünland, auf dem Heu gemacht wurde. Direkt am Hof gab es noch einen großen Gemüsegarten mit den üblichen Arten - besonderes Augenmerk wurde auf haltbaren Kohl gelegt, der in Salzlake eingelegt wurde. Zusätzlich gab es 24 Obstbäume: (Wirtschafts-) Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen. Auf "ihre" Obstbäume war Berta Tuttlies besonders stolz. Die Bäume wurden nur auf Anweisung von ihr zurückgeschnitten - beim Obst Ernten mussten aber alle mithelfen.
In einer besonders sonnigen Gartenecke baute Ferdinand Tuttlies seinen eigenen Tabak an, was aber aufgrund des teilweise rauen Klimas nicht jedes Jahr gelang. Zollfrei waren 20 Tabakpflanzen. Zwei "Spezialisten" aus dem Dorf Willschicken hatten aber in versteckten Winkeln kleinere Tabak-Felder heimlich angelegt, mit weit mehr als 20 Pflanzen, mit denen sie Geld verdienten. Zoll zahlten sie aber nicht und ihre Tabakkäufer schwiegen. Als Anfang der Dreißigerjahre übereifrige Zoll-Beamte in der Lindenhöher Schule die Schulkinder nach dem Tabak-Anbau ihrer Eltern abfragen wollen, kam es heftigen Beschwerden beim Schulrat.
Nachbaren der Tuttliesen hatten in einem Bruchgelände Schnittweiden gepflanzt, um daraus im Herbst und Winter Körbe, Peitschenstiele und Angelruten herzustellen. In den Randbereichen der Sumpfgelände wurde von den Tuttliesen auch Flachs angebaut. Der Flachs wurde bis zum Brechen und Ausdreschen in der Scheune gelagert. Aus den feingesponnen Fäden wurde Leinen gewebt und aus den groben Fäden wurden Säcke gewebt und man drehte Stricke - alles Arbeiten, für die Frauen zuständig waren. Der Winter war für die Frauen auch Strickzeit für die Frauen. Besonders Wäsche und Kinderkleidung waren Strickprodukte. Es kam Schafswolle zum Einsatz, die laut aller Kinder, immer und überall entsetzlich kratzte.
Alle größeren landwirtschaftlichen Geräte waren einfacher Art und zum Teil vererbt oder günstig gebraucht erworben. Es waren nach der Erinnerung von Hildegard Tuttlies vorhanden: ein Schwing-Pflug, ein Tiefpflug, eine Drillmaschine, eine Rechenmaschine, ein Kartoffel-Häufler, ein Kartoffel-Roder, vier Eggen, zwei Ackerwagen, ein Kastenwagen und ein großer und mehrere kleine Schlitten. Bei Bedarf konnten zusätzliche Gerätschaften von Nachbaren oder vom Familien Clan ausgeliehen werden.

Der größere Teil der Ernte wurden von der An- und Verkaufsgenossenschaft in Aulowönen aufgekauft. Ferdinand Tuttlies war als "Genosse" Mitglied und besaß einen kleinen Genossenschaftsanteil. Die Milch landete hauptsächlich in der Molkerei Pukris in Willschicken und diente zum Eigenverbrauch. Die Milch wurde selber zu Erzeugnissen wie Schlagsahne, Dickmilch, Quark, Buttermilch, Käse und Butter verarbeitet. Das Buttern der Milch zu Hause war für die Tuttliesen Kinder eine der unerfreulichsten Arbeiten - es war langweilig und dauerte viel zu lange. Die Ernteerlöse und das Milchgeld reichten etwa für ein Dreivierteljahr, um die Haushalts-Kosten zu decken. Kunstdünger wurde wegen der Kosten nur begrenzt gekauft. Das Jahreseinkommen aus der Landwirtschaft betrug durchschnittlich etwa 1.200 Mark. Die teuersten Posten bei den Tuttliesen waren Kaffee, elektrischer Strom und Lederschuhe. 1926 betrug Monatslohn in Deutschland durchschnittlich 139 RM, bei einem Kaffee-Preis von 7,20 RM. Man musste also auf dem Lande in Ostpreußen ungefähr 20 Stunden für ein Kilo Kaffee arbeiten (siehe auch Hof Brandstäter und Monatslohn Entwicklung [24] ). Die Bauern auf dem Landen versorgten sich mit Nahrungsmitteln und Brennmaterialien in der Regel selber. In Salzlake Einlegen, Räuchern und Einwecken diente auf den Höfen der Haltbarmachung. Gekauft wurden nur Lebensmittel oder Dinge, die nicht selbst hergestellt werden konnten oder aus dem Ausland herangeschafft werden mussten. Der Einkaufs-Laden von Fritz Lerdon führte den Untertitel "Kolonialwaren".
Ferdinand Tuttlies war zusätzlich im Sommer als gelernter Maurer und im Winter als angelernter Schneider erfolgreich tätig. Er wurde zum kleinen Dorfschneider, den jedes Dorf hatte. "E kleenet Etwas öss beter als e grotet Garnuscht". Beim Mauern hatte er sich bei filigranen Ausbesserungen einen Namen gemacht. Die Maurerlehre hatte er vor seiner Hochzeit bei seinem Onkel in Aulowönen gemacht. Beide Nebenerwerbe hatte er steuerlich angemeldet.
Ferdinand Tuttlies „benähte“ im Winter regelmäßig seine Stammkunden, die Nachbaren, Verwandte, Bekannte und Schulfreunde "für ein paar Dittchen". Das Schneidern hatte ihm Gertrud Kianka aus dem Nachbardorf Paducken beigebracht - eine gelernte Schneiderin. Ihr Hof lang in Sichtweite des Hofes von Ferdinand Tuttlies. Frau Kianka war langfristig an Rheuma erkrankt, da sie im Winter ihre Kate nicht ausreichend heizen konnte. Sie "hatte zu lange im Kalten genäht". Ferdinand Tuttlies hatte dann wesentlich den Einbau eines Kachelofens bei Frau Kianka im Rahmen einer Talka mit organisiert. Dafür wurde er von ihr im Winter als Schneider angelernt. Frau Kianka freute sich über "die flotten Hände von Ferdinand". Einige Nachbaren wunderten sich auch über die „flotten Hände“, die im Sommer mauerten und im Winter nähten, dazu kam noch die übliche Hofarbeit. Die Zufahrt zur Hofstelle Kianka lag westlich neben dem Soldatengrab, dass vor dem Tuttliesen Hof gelegen war. (siehe Kapitel 9.4 Soldatengrab). Frau Kiankas Mann war verstorben und sie lebte dann später unverheiratet mit Herrn Bundel zusammen, um besser versorgt zu sein.
Ferdinand Tuttlies übernahm von Frau Kianka eine gusseiserne "Singer-Nähmaschine" mit Fußantrieb und Holzabdeckung, dazu zwei großen Schneider-Scheren und ein riesiges Dampfbügeleisen. Dazu kam ein wichtiger Schrank, in dem etwa 50 Schnittmuster aus Zeitungspapier von Frau Kianka lagerten. Ein selbstgebauter Schneidertisch und ein Stoffregal mit Kurzwaren vervollständigten seine "Extra-Schneider-Stube" im 1. Stock. Sie wurde im Winter, wie die Schlafzimmer, durch den Warmluft-Kanal des Kachelofens mit beheizt. Bei besonders strengen Wintern wurden aber noch zusätzliche Öfen, die einen Abzug zum Hauptkamin besaßen, angeworfen. Die extra langen Ofenrohre in den Zimmern wärmten mit. Die Schneider-Stube besaß aber auch noch einen separaten "Schneiderofen" für das Dampfbügeleisen. Sein ganzer Stolz war ein bodenlanger Spiegel und ein Kundensessel mit Lederbezug. Beide Gegenstände waren Überbleibsel des "russischen Rotes Kreuz Hauses " aus dem 1. Weltkrieg. (siehe Kapitel 9.4 Soldatengrab). Sie sollen ursprünglich wohl von einem besetzten Gut der Umgebung herstammt und landeten während der russischen Besatzung bei den Tuttliesen im "Ärzte-Zimmer", es war die "Extra-Schneider-Stube".
Die Stoffe kauft Ferdinand Tuttlies nach einem bestens gehüteten Katalog auf Bestellung per Post in Insterburg ein und holte sie persönlich ab, und zwar bei der Tuchhandlung Rosenberg Gebrüder & Simon, Insterburg. Die ganz Familien musste seine Bestellung (Korrektur)lesen. Für ihn war es jedesmal eine aufregende Tagesreise. Dazu zog er jedesmal sein "englische" Jacke an - ein Sakko aus groben Tweed und eine Manchesterhose aus Cord, eine Kombination, an der auch einige Großbauern in der Umgebung Gefallen gefunden hatten. Eine Schiebermütze und von den Kindern sorgfältig geputzte Schnürstiefel vervollständigten seinen Auftritt. Mutter Berta hatte ihm eine Stulle für die Hinfahrt und eine Stulle für die Rückfahrt geschmiert. Während der deutschen Kolonialzeit wurden die Winteruniform der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika aus Cord hergestellt, daher war Cord auch in Ostpreußen bekannt. Er setzte auch jedesmal seinen selbst genähten Extra-Schneiderrucksack auf, der regendicht war; es gab auch einen entsprechenden Maurerrucksack. - "Man must e weete wat em koft" - Für die Kinder war seine Rückkehr heiß ersehnt, da er in den Taschen seines Rucksackes stets "Bomche" mitbrachte. Es verging mindestens eine Stunde, bis er zu Hause von all seinen Erlebnissen in der Bahn und in der Stadt erzählt hatte - alle waren mucksmäuschenstill und hörten gespannt zu. Auch auf dem Wochenmarkt in Aulowöhnen konnte man auch Stoffe und Kurzwaren auf Vorrat erstehen. Das Geschacheriche auf dem Markt sagte Ferdinand Tuttlies aber nicht zu, seine Frau Berta begleitete ihn dann jedesmal bei diesen Einkäufen. Manchmal kaufte er auch im Textilgeschäft Wilhelm in Aulowöhnen ein. Hier war aber die Auswahl nicht sehr groß. Die Kinder durften seine "Extra-Schneider-Stube" nur nach "ausdrücklicher" Anmeldung betreten.
Nach dem 1. Weltkrieg gab es an den Häusern viel zu reparieren. Im Sommer baute er "gegen Geld" für die „Baugesellschaft Königsberg“ bis 1930 bei den Neusiedlerhäusern in Alt Lappönen in Teilzeit beim Innenausbau mit. Auch hier wurde während der Inflation mit Naturalien bezahlt. Von Dezember bis Januar gab es für Maurer kaum Arbeit und Lohn, in den Monaten Februar, März, Oktober und November mäßige Aufträge und Einkommen. Die meiste Arbeit und vollen Lohn gab es von April bis Oktober. Ferdinand Tuttlies hatte sich Maurer für Innenausbauten einen Namen gemacht. Er wurde aufgrund seines Rufes auch von Gütern der Umgebung angefragt. Manchmal, aber sehr selten, bedingten sich Schneider und Maurer in der einen Person von Ferdinand Tuttlies auch vor Ort. Ob er dann mit zwei Rucksäcken gefahren ist, ist nicht erinnert worden.
Während der Sommermonate wurden auf dem Tuttliesen Hof bis zu 4 noch nicht schulpflichtige Waisenkinder aus Insterburg untergebracht. Dies besserte den finanziellen Haushalt der Familie noch zusätzlich auf. Ab Oktober 1940 wurden Schulkinder sowie Mütter mit Kleinkindern aus den vom Luftkrieg bedrohten deutschen Städten längerfristig in zur damaligen Zeit weniger gefährdeten Gebieten wie z. B. Ostpreußen untergebracht. Die „Reichsdienststelle KLV“ evakuierte bis Kriegsende insgesamt wahrscheinlich über 2.000.000 Kinder und versorgte dabei vermutlich 850.000 Schüler im Alter zwischen 10 und 14 Jahren und älter. Auch deren Rückkehr verlief teilweise viel zu spät und unter oft chaotischen Bedingungen. Auf dem Hof der Tuttliesen wurde Anfang 1941 eine Hausfrau mit 2 schulpflichtigen Kindern aus Köln einquartiert. Ihre Wohnung in Köln war zerbombt und ihr Mann an der Front. Es kam aber zu Spannungen zwischen den Familien. Die Kölner zogen aber bald ins traditionell katholische Ermland weiter, da die Tuttliesen aber auch das Dorf "nicht genug katholisch" waren. Auf einigen Höfen in Willschicken wurden Kinder durch die Kinderlandverschickung (KLV) untergebracht, die in Lindenhöhe auch zur Schule gingen.
Auf den anderen Kleinbauerstellen arbeiteten die Besitzer häufig Teilzeit bei den Großbauern und Gütern über das ganze Jahr verteilt. Straßen- und Eisenbahnbau und der Holzeinschlag, die Moorkultivierung und der Wasserbau waren zusätzliche Arbeitsmöglichkeiten. Seit 1935 bot sich auch die Wehrmacht als "Alternative" an. Zur Erntezeit wurden auf den Gütern zusätzliche Saisonkräfte angeworben. Nach wie vor mussten die bäuerlichen Nichterben sich außerdörfliche Arbeitsplätze suchen. Bei den Tuttliesen waren zu Kriegsanfang die Kinder Max Tuttlies Kaufmann in Insterburg, Friedel Tuttlies Hausmeisterin in Königsberg, Hildegard Tuttlies Angestellte in Paßdorf. Nur Erich Tuttlies wollte als gelernter Maurer in Wilkental bleiben und der Hof übernehmen.
Erich Tuttlies arbeitete, nach seiner Mauerlehre im Baugeschäft seines Großvater in Aulowönen, von 1925 bis 1933 als Maurer in einer Baukolonne, die von Baustelle zu Baustelle zog und ihr Werkzeug mitbrachten. Sie bestand aus einem soliden sozialen Netzwerk von bis zu 12 miteinander vertrauen Mauren aus dem Kirchspiel Aulowönen, das sich auch bei Notfällen wie Unfällen unterstützte, die Löhne vor Ort aushandelten, aber keine Firma war. Vor dem eigenen Hausbau gehörte auch Ferdinand Tuttlies dazu, der aber nach der Familiengründung nicht mehr wochen- oder monatelang umherreisen mochte. Die Kontakte zu den Bauherren - es waren ganz überwiegend Gutsbesitzer - kamen in der Regel durch persönliche Beziehungen oder durch Empfehlungen zustande. Später kamen auch seriöse und unseriöse Vermittler dazu. Die Kolonne arbeitete neben dem Landkreis u.a. punktuell auch in Städten wie Insterburg, dann in Königberg und mit Zwischenstationen sogar auch in Berlin, hier an einem großen Geschäftshaus in Berlin Mitte - es soll heute noch stehen. Auch das Berline Objekt gehörte einem vermögenden Gutsbesitzer aus dem Landkreis Insterburg, der es als Geldanlage bauen ließ. Erich Tuttlies hatte "während seiner Zeit in Berlin Sachen gesehen, von denen er nie was in Willschicken gehört hatte."
In Ostpreußen waren äußere Bauarbeiten auf Grund des langen Winters nur von April bis Oktober möglich. Im Winter waren dann alle Maurer wieder zu Hause. Während der Inflation 1918 - 1924 und der Weltwirtschaftskrise 1929 - 1933 war es fast unmöglich in den Städten Arbeit zu bekommen. Auf dem Lande war die Situation nur zu Teil etwas besser. Während der Wirtschaftskriese gab es eine "Flucht in Immobilien", was den Bauleuten nur zum Teil half - Aus- und Umbau waren jetzt angesagt. Für Neubauten gab es keine Kredite mehr. Die Konkurrenz war auch hier sehr groß, besonders von polnischen Bauarbeitern, die "unter Preis" arbeiteten. Von 1929 bis 1933 verloren in Ostpreußen fast zwei Drittel der in Bau- und Baunebengewerbe abhängig Beschäftigten ihre Arbeit - ca. 35.000 Handwerker wanderten ab. Viele Arbeitslose belasteten als billige Schwarzarbeiter den Markt, andere suchten sich durch Gründung von Kleinstfirmen über Wasser zu halten. Bezahlt wurde während der Wirtschaftskriese und der Inflation, wie auf dem Lande üblich, teilweise oder ganz in Naturalien. Geschlafen wurde in der Regel auf den Baustellen. Zum Teil wurden die Bauleute aber auch systematisch um ihren Lohn betrogen. Bei Protesten wurden dann die Arbeiter von der gerufenen Polizei, teils unter Waffengewalt, von der Baustelle vertrieben. Einige Gutsherrn hatten sich einen besonders schlechten Ruf "erarbeitet". Es wurden aber auch Fälle bekannt, in denen das zuvor Erbaute von den betrogenen Bauleuten nachts heimlich wieder eingerissen wurde.
Erich Tuttlies hatte den Hof seiner Eltern zwar schon 1932 überschrieben bekommen, auch weil Vater Ferdinand krank geworden war, hatte aber von 1933 bis 1935 hatte eine Stelle in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme am Masuren Kanal erhalten, die er auch antrat. Bis zu seiner Einberufung 1938 war er dann nur auf dem Tuttliesen Hof tätig.
„Die Faustregel hieß, dass man ein Besitztum bis zu zehn Hektar mit der eigenen Familie bewirtschaften konnte; ging es um zehn bis zwanzig Hektar, brauchte am öfters, von zwanzig Hektar ab regelmäßig fremde Arbeitskräfte“ [25]. Höfe ab 20 ha konnten ihre Besitzerfamilien in Wilkental bei guten Ernten das ganze Jahr über sicher ernähren und kleinere Rücklagen z.B. in Form von Genossenschaftsanteilen bilden. Langanhaltende Winter wie 1928/29 führten in Ostpreußen teilweise zu Missernten.
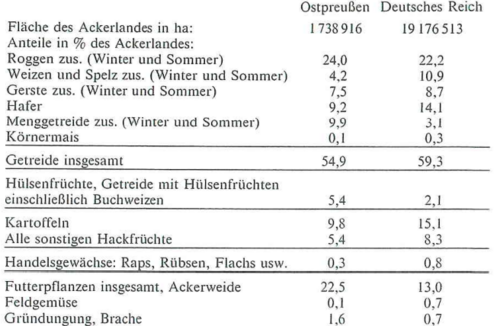
Bei den Großbauern und den Gütern waren die Ernteerträge sehr von den vorhandenen Arbeitskräften abhängig. Hinzu kamen das Wetter und die jeweiligen Konjunkturlagen. Aus der beigefügten Tabelle ist zu ersehen, dass das Getreide mit 54,9 % Fläche des Ackerlandes in Ostpreußen die "führende Ackerfrucht" war. 1932 stammte das Korn für jedes 10. Brot, das im Deutschen Reich gegessen wurde, aus Ostpreußen.
Auf dem Hof der Familie Tuttlies wurden hauptsächlich Roggen und Kartoffeln angebaut, außerdem wurde Heu gemacht. Vor der Aussaat wurden die Felder gedüngt, gepflügt und geeggt. Das Getreide wurde per Hand ausgesät - später mit der Drillmaschine. Beim der Getreideaussaat musste es der Petkuser Saatroggen sein, gezüchtet von Ferdinand von Lochow (1849 - 1924). Ferdinand Tuttlies sagte dazu "Ferdinandche is good voor us".
Das Getreide wurde per Hand mit Sensen gemäht und zu Hocken aufgestellt. Nach dem Trockner wurde das Getreide gedroschen. Nach der Abfuhr der Hocken wurden die Felder noch abgeharkt. Dieses Reststroh wurde auch zum Ausstreuen der Ställe benutzt. Größere Höfe hüteten noch Kühe auf den abgeerntete Felder, und zwar wenn der miteingesäte Kleesamen nach dem Schnitt etwa 10 cm frisches Grün hervorgebracht hatte.
Viele Ostpreußen bezeichnen die Erntezeit, die „Austzeit“ zu Hause als schönste Zeit des Jahres, wenn sie auch den meisten Schweiß kostete. Bei der Getreideernte herrschte die traditionelle Arbeitsteilung vor. Mitglieder des Familien Clan der Tuttliesen und vertrauten Nachbaren traten zur Ernte an. "Wenn der Lindenbaum zu Johanni seine Blüten offen hat, dann ist auch zu Jakobi der Roggen reif". Zunächst wurden die "langen" ostpreußischen Sensen entrostet, dann mit Hämmern gedängelt. Die Bauernwagen wurden zu Leiterwagen umgebaut und verlängert. Die Pferde bekamen eine Extraportion Hafer. Ferdinand Tuttlies erteilte als "Schnittmeister" vor Beginn einen kleinen Segen und ging voran, dann folgten die Söhne seiner Familie und danach die anderen Männer. Jedem Schnitter folgten zwei Binderinnen. Gearbeitet wurde von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Tuttliesen benötigten zur gesamten Mad etwa vier bis fünf Tage, abhängig vom Wetter, von der Personenanzahl und deren Können.
Die Männer schnitten das Korn mit ihren eigenen Sensen. Die Stiellänge der Sensen musste zur Körpergroße passen. Nach etwa 50 Schnitten wurde mit dem mitgeführten Schleifstein nachgeschärft. Vier bis fünf Schnitte reichten für eine Garbe. Die Frauen hoben die Schnitte auf und banden die Roggenähren im Stehen zu einer Garbe. Beim Binden wurde zwischen kurz gebunden und Langbinden unterschieden. Beim Kurzbinden wurden die Köpf der Ehren umgeknickt, beim Langbinden nicht. Maßgeblich war die Weiterverarbeitung. Das Binden selbst wurde mit Roggenähren ausgeführt, Binde-Seile konnten sich nur rentable Güter leisten. Danach wurden die Garben niedergelegt und am Abend in schrägen Hocken aufgestellt, damit eventueller Regen besser ablaufen konnte. Die Garben blieben bei gutem Wetter einige Tage als Zwischenlager auf dem Feld stehen. Drohte Regen, so wurden die Roggengarden schnell in die Haus Scheune gefahren. Das verursachte jedesmal wegen der zusätzlichen Arbeit große Aufregung und war noch jahrelang Gesprächsthema in der Tuttlies Familie. Bei gutem Wetter wurde, wenn alle Hocken aufgestellt waren, rasch eingefahren. Die großen Kinder fuhren mit auf den Erntewagen, die kleinen Kinder jagten nach Mäusen, die sich in den Hocken versteck hatten.
War der Dreschtermin angesagt, wurden die Getreidegarben zum Dreschen jeweils mit zweispännigen Fudern auf den Hof der Familien Burba in Paducken - den Eltern von Berta Tuttlies - gefahren. Es waren, je nach Ernte, etwa 10 - 15 Fahrten notwendig und es musste schnell gehen. Hier stand ein in der sehr geräumigen Korn-Scheune der Lohndreschkasten, der vom gesamten Burba- und Tuttliesen-Clan gemietet wurde. Der fahrbare Dreschkasten - er war von der Fa. Rudolf Wernike in Heiligenbeil gebaut worden - wurden von einem Lanz Bulldog mit Rundscheibe über einen Treibriemen angetrieben. Das Be- und Entladen des Dreschkasten nahmen die Tuttliesen vor, sie waren mit dem Dreschkasten vertraut. Dabei dauerte es eine Weile, bis alle Maschinen geradegestellt waren, damit die Kraftübertragung vom Schwungrad des Traktors auf die Dreschmaschine auch gut war. Es brauchte ziemlich viel Personal, vor allem einen Maschinisten und einen Einleger. Alle jungen Männer wollten einmal Maschinist sein. Dazu kamen noch 5–6 Personen als Handlanger. Das Dreschen in der Scheune war aber extrem staubig, nach etwa jeder Stunde mussten draußen nach Luft geschnappt werden. Nach dem Drusch wurde zusätzlich in einer per Hand betriebenen "Putzmühle" nochmals Getreide und Spreu getrennt und dann das Getreide eingesackt. Das Dreschen der Familie Ferdinand Tuttliesen dauerte etwa 2 - 3 Tage, vorher und nachher waren die anderen Tuttliesen und Burbas an der Reihe, es folgten weitere Familien. Generell wurde mit dem Dreschkasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet. Je nach dem Getreidewachstum wurde der Dreschkasten etwas 4 - 6 Wochen gemietet. Wie immer, war auch hier Regen ein Spielverderber.
Vor dem Einsatz von Dreschkästen wurde auf den kleinen Höfen mit der Hand gedroschen. Auf den Gütern war das die Aufgabe von Insten und freien Lohnarbeiter. Die Dreschsaison dauerte hier häufig von Oktober bis zum nächsten April des nächsten Jahres. Als Zwischenstufe wurden auch Pferde-Göpel eingesetzt. Mit dem Aufkommen der Dreschkästen verloren große Teile der Lohnarbeiter schlagartig ihre Arbeitsgelegenheiten - was früher auf großen Gütern 4 - 6 Monate gedauert hatte, wurde jetzt in 4 - 6 Wochen vom Gesinde erledigt.


Der größere Teil der Körner-Ernte wurden zur An- und Verkaufsgenossenschaft in Aulowönen gefahren, das Stroh zur Haus-Scheune der Tuttliesen. Die Erträge bei den Tuttliesen lagen, abhängig vom Wetter, etwa bei 18 Doppelzentner Rogen pro Hektar Ackerland. Roggen wurde auf etwa 6 Hektar Land angebaut. Da auch andere Familien sehr stark am rechtzeitigen Drusch interessiert waren, gab es regelmäßig "Schachereien" um einen günstigen Termin. Häufig wurden diese "Verhandlungen" auch in der Gaststätte Lerdon geführt.
Bei den Kartoffeln wurden schon ein Häufler und ein Kartoffel-Roder eingesetzt, der von zwei Pferden gezogen wurde. Das Aufsammeln erfolgte per Hand. Hier dauerte die Ernte bei den Tuttliesen zwei bis drei Tage. Nach der Einberufung der Männer 1935 wurden auch Schulklassen zur Kartoffelernte eingesetzt. Auf den Gütern der Umgebung verdienten sich auch die schulfrei gestellten Kinder aus den umliegenden Dörfern zum Kartoffelsammeln: Neben den Mahlzeiten bekamen sie 50 Pfennig pro Tag - aber nur, wenn sie mindestens die Hälfte der Erwachsenen schafften, sonst blieb es nur bei den Mahlzeiten. Hildegard Tuttlies hatte als junges Mädchen auch einmal diese Erfahrung gemacht. Sie meine: Einmal reicht es! Die 50 Pfennige bekam sie nachträglich von ihren Eltern.
Im Herbst gab es große Feuer, auf denen das Kartoffelkraut verbrannt wurde. Das ganze Dorf Willschicken "duftete" dann nach Kartoffelkraut. Die außerhäusliche Kartoffelmiete war im Winter auch ein Anziehungspunkt für Wildschweine. Die Ernten wurden privat jeweils mit einem großen Fest mit üppigem Essen und Trinken und viel Gesang abgeschlossen. Vor dem 1. Weltkrieg wurden die Erntewochen nach Festsetzung des Gutsherrn von Alt Lappönen durch den Dorfpfarrer verkündet. Sie galten hauptsächlich für die nebenerwerblichen Dorfbewohner in den umliegenden Gemeinden von Alt/Neu Lappönen und Keppurlauken, die zur Erntehilfe angeworben werden mussten. Nach diesen Terminen richtete sich aber das gesamte Dorf Willschicken. Im selben Zeitraum waren in der Schule in Lindenhöhe alle entsprechenden Kinder freigestellt. Das Erntefest wurde auch von den Dorfautoritäten - mit einem Umtrunk im Gasthaus Lerdon, der Schule - mit einem Umzug durch das Dorf und der Kirche mit einem Gottesdienst begangen, dabei wurden jeweils angefertigte Ernte-Kronen überreicht. Bei den größten Gütern der Umgebung wurde eine Erntekrone dem Gutsherrn überreicht.
Quelle: Vom Roggenband und vom Plon - Ostpreussen Portal
Nach der Reformation wurde das Erntedankfest in den Kirchen an unterschiedlichen Daten gefeiert. Einige evangelische Kirchenordnungen „verbanden den Dank für die Ernte mit Michaelis, andere legten ihn auf den Bartholomäustag (24. August), auf den Sonntag nach Ägidii (1. September) oder nach Martini (11. November).“ Schließlich bürgerte sich die Feier am Michaelistag (29. September) oder – weit überwiegend – am ersten Sonntag nach Michaelis als Termin ein. Diese Regelung geht u. a. auf einen Erlass des preußischen Königs aus dem Jahre 1773 zurück. Dies konnte dazu führen, dass das Erntedankfest noch in den September fällt. Im Dritten Reich wurde dann mit viel Pomp ein zentrales Erntedankfest zelebriert. 1933 verfügte Adolf Hitler zunächst, dass das Erntedankfest zentral am ersten Sonntag im Oktober gefeiert werden sollte. Mit dem Gesetz über die Feiertage vom 27. Februar 1934 wurde der Erntedanktag am ersten Sonntag nach dem 29. September (Michaelis) gesetzlicher Feiertag. An diesem Tag würdigte das NS-Regime auf der Grundlage der Blut-und-Boden-Ideologie besonders die Bedeutung der Bauernschaft für das Reich. Zentrale Veranstaltung war das Reichserntedankfest, mit dessen Organisation das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda beauftragt war.
Das Leben auf dem Lande durch den Nationalsozialismus zu beeinflussen, gelang nur teilweise. Gravierender waren die erlassenen rechtlichen Vorschriften, die auch sanktioniert wurden. Im Arbeitsalltag der Bauern war der ideologische Anspruch der Nationalsozialisten, Frauen auf ihre Mutterrolle zu reduzierte, bloße Propaganda. Während des Krieges wurden Lebensmittelkarten eingeführt, so wurde auch der Anspruch autark zu sein, zur Propaganda. Am gravierendsten waren jedoch der Einzug der Männer zum Krieg und wurde so für die Frauen zu Hause zur Doppelbelastung. Berta Tuttlies schaffte die Arbeit nicht mehr und die Kinder Hildegard und Erich kehrten auf den Hof zurück. Vater Ferdinand Tuttlies war zum "Schanzen" abkommandiert und wurde krank. Hilfskolonnen der HJ, des BDM und des RAD, dazu Tausende von Mädchen, die das neugeschaffene „Pflichtjahr“ in einem Haushalt absolvieren mussten, wurden zum „Ernteeinsatz“ in Ostpreußen abkommandiert, ohne jedoch die eingezogenen Männer ersetzen zu können. Auch die zwangsrekrutierten Ostarbeiter, Kriegsgefangen und KZ-Häftlinge konnten diese Lücke nicht schließen. Siehe dazu auch den separaten Text Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)
Das Leben auf dem Lande - auch während des Nationalsozialismus - war in Willschicken im Wesentlichen durch Alltagsroutinen geprägt. Dazu zählten die wiederkehrenden Aktivitäten an verschiedenen Orten. Was muss wie, wann und wo gemacht werden und wie komme ich dahin? Der so entstandene "Aktivitätsraum" setzte sich zusammen aus den verschiedenen Aktivitätsarten und den unterschiedlichen Aktivitätsorten. Die Aktivitäten kann man unterschieden nach Art, Häufigkeit, Zeitpunkt, Zeitdauer und Ort[29]. Es gab es für die Tuttliesen auch höchst unterschiedliche Gelegenheiten aktiv zu werden, sowohl in den Nachbargemeinden als auch zu Hause (siehe auch die folgende Tabelle). Für längere Distanzen wurden die vorhandenen Verkehrsmittel gebraucht. So wurde der Aktionsraum auch durch äußere Einflüsse beeinflusst. Mal regnete es, mal war das Fahrrad kaputt, mal war der Einkaufsladen geschlossen.
Bei längeren Distanzen war auch das "Koppeln" von Aktivitäten interessant. Nach dem Marktbesuch, die Gaststätte aufsuchen um danach bei Onkel Otto vorbeisehen und dann nach Hause fahren. In der Fortbildungsstätte für Landwirte in Königsberg wurden solche "Koppelungs-Tabellen" differenziert unterrichtet, um so auf "modernen" Gütern so auch kleinteilige Arbeitsabläufe mit Hilfe von REFA zu optimieren. Der REFA – Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e. V. ist Deutschlands älteste Organisation für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Die Abkürzung REFA geht auf den ursprünglichen Namen im Jahr 1924 zurück: Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung.
Auf dem Gut Neu Lappönen wurde möglicherweise auch die Zeit-Erfassung angewandt. Ferdinand Tuttlies war einmal eher zufällig in seiner Nebentätigkeit als Maurer in einem Gesindehaus des Gutes tätig. Als plötzlich ihm von einem Unbekannten ein Formular unter die Nase gehalten wurde. Er war wohl irrtümlich für einen Gutsarbeiter gehalten worden. Er sollte seine Arbeitszeit mit einem Bleistift selbst in die Tabelle eintragen. Er waren die genaue Minutenlänge seiner Arbeiten im Gesindehaus aufzuschreiben. Das widersprach allerdings den strengen REFA-Grundsätzen, die dafür einen separaten "Zeit-Erfasser" und sehr genaue Regeln vorsahen. Der Fremde wollte aber nicht bleiben, "er habe sofort im Gutshaus etwas sehr Wichtiges zu erledigen" und verschwand. Ferdinand Tuttlies sagte dazu, "dass es in beiden Häusern wohl eher sehr sehr unterschiedlich gerochen habe." Er konnte auch mit dem Formular allein nichts anfangen, da er auch keine Uhr hatte. Da der fremden "Zeit-Erfasser" nicht wieder auftauchte und der Zahlmeister des Gutes ihm auch nicht helfen konnte, brachte er stolz das leere Tabellen-Formular und den Bleistift mit nach Hause, um sie von der Familie bestaunen zu lassen. Das Formular ist im Krieg verloren gegangen. Der Vorschlag zu Hause Zeit zu messen und aufzuschreiben, ging in Gelächter unter.
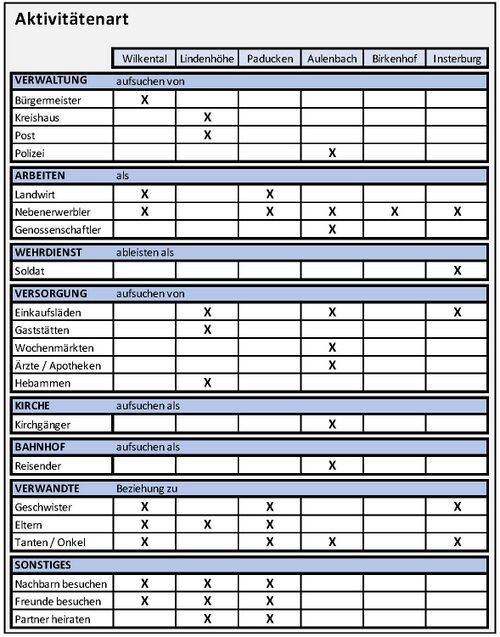
Bei Anbahnungen von Heiraten und Bekanntschaften gingen die Aktionsräume der Dorfbewohner von Willschicken gewöhnlich nicht über einen Radius von 20 km kaum hinaus. Die 40 km Wege-Distanz für den Hin- und Rückweg konnte man früher an einem Tag in etwa 10 h Fußweg zurücklegen. Der Radius war bezogen auf die "alten" Verkehrsmittel zu Fuß gehen (4 km/h) oder mit dem Pferdewagen (10 km/h) oder dem Rad fahren (15 km/h), den Zustand der Straßen und Wege und die Jahreszeit. Im Winter engte sich Aktionsraum auf den eigenen Hof ein. Der Autoverkehr spielte im Landkreis Insterburg bis zum Kriegsende kaum eine Rolle. Dies galt auch, wenn vorhanden, für das Aufsuchen von Ausbildungs- und Arbeitsstellen. Ausnahmen bildeten die Distanzen, die für das Erreichen des Militärdiensts oder die weiterführende Ausbildung zurückgelegt werden mussten. Hier kam schon die Kleinbahn ab Aulenbach in Spiel. Die Aktivitäten der Tuttlies in der Heimat-Gemeinde nahmen einen großen Zeit-Anteil ein. Aber nicht alles konnte zu Hause erledigt werden. So mussten häufig auch die Nachbargemeinden aufgesucht werden, da es nur hier die entsprechenden Gelegenheiten gab.
Zu den speziellen Aktivitäten musste man sogar in die Kreisstadt Insterburg per Kleinbahn fahren.
Die Gemeinde Willschicken war von folgenden Nachbargemeinden umgeben:
- Pillwogallen später Lindenhöhe
- Paducken später Padau
- Aulowönen später Aulenbach
- Keppurlauken später Birkenhof
Die nebenstehende Tabelle versucht, eine ungefähre Übersicht der routinierten Aktivitätsarten und der bekannten Aktivitätsorte (Gemeinden) der Tuttliesen zu geben.
Es fällt auf, dass sich die Tuttliesen in ihren sozialen Aktivitäten stark zu ihren Nachbargemeinden Lindenhöhe und Paducken hin orientiert haben. Sie lagen auch räumlich näher zum Hof der Tuttliesen. Diese tatsächlichen Aktionsorte in Lindenhöhe und Paducken hatten demnach eine höhere Attraktivität als die möglichen Orte in Wilkental. Zur Nachbargemeinde Keppurlauken später Birkenhof gab es bis auf sporadische Mauerarbeiten von Ferdinand Tuttlies kaum Kontakte, was sicherlich auch an der relativ in sich geschlossenen Sozialgemeinschaft des dortigen Gesindes der Güter lag, die dort auch eine eigene Schule besaßen, so dass die dortigen Kinder zu anderen Nachbargemeinden kaum Kontakt hatten. Im Allgemeinen war die Schule eine großer "Kontakt-Anbahner" zwischen den Bewohnern in den verschiedenen Gemeinden. Hier lernte man sich zuerst kennen. Diese Gemeinde besaß auch die größte räumliche Distanz zum Tuttliesen-Hof.
Die Tabelle soll zeigen, dass die Tuttliesen auf dem Lande in einer relativ abgeschlossenen und überschaubaren Welt lebten. Wer in dieser kleinen Welt keinen Arbeitsplatz gefunden hatte, musste seine Heimat aber verlassen, um woanders unterzukommen. Die eingetragenen Nennungen in der Tabelle stammen aus der Erinnerung von Hildegard Tuttlies, verh. Kiehl. Sie sind rein subjektiv und enthalten keine Häufigkeiten und Zeitdauer. Ebenfalls ist nicht angegeben, für welche Familienmitglieder die Erinnerungen gelten. Auch ein genauerer Ortsbezug innerhalb der Gemeinden wäre zwar wünschbar, war aber nicht zu leisten. Es wird aber dabei geschätzt, dass durch die Tabelle der größte Zeit-Anteil der täglichen Routinen der Tuttliesen abgedeckt wurde. Ausnahmen wie Ferien, Krankheiten oder Aufmärsche wurden nicht berücksichtigt.
Willschicken und seine Nachbargemeinden
Willschicken war von den Gemeinden Lindenhöhe, Paducken, Aulowönen und Keppurlauken umgeben.
Familie Tuttlies und Pillwogallen / Lindenhöhe

Pillwogallen wurde 1681 zuerst erwähnt und besaß 1785 als Chatouldorf 20 Feuerstellen. Pillwogallen lag in Ostpreussen im Regierungsbezirk Gumbinnen. Das Amtsgericht und das Bezirkskommando befanden sich in Insterburg. Das Standesamt lag in Grünheide. Der Amtsbezirk für Pillwogallen war Groß Franzdorf. In Pillwogallen lag mit dem Kreishaus auch das Bezirksamt von Groß Franzdorf. Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch. Quelle: Meyer Orts- und Verkehrslexikon (1912)
An Wegkreuzungen wurden während der Besiedlung von Ostpreußen von 1700 -1800 gezielt „Krüge“ errichtet, das waren damals einfachste Gastwirtschaften (mit oft nicht mehr als sechs Trinkgefäßen) oder Herbergen, die ebenfalls mit Deutschen besetzt wurden, die die Aufgabe hatten, der deutschen Sprache und Kultur als Multiplikator zu dienen, da an diesen Treffpunkten auch die einheimischen Littauer einkehrten. Die Krüger waren bis zum 1. Weltkrieg verpflichtet, wenn in der Gaststube Gesetzesverstöße oder "unziemliches Verhalten" bekannt wurden, die Landgendarmerie zu benachrichtigen. Die Landgendarme hatten ihrerseits in den Krügen häufig auch schon feste Sitzplätze. Der Standort des Kruges in Pillwogallen hat sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges erhalten. Hier lag auch das Kolonialwarengeschäft mit Gastwirtschaft mit Saalbetrieb der Familie Kiehl/Lerdon.
Am 23. 2. 1931 erfolgte Umbenennung der Landgemeinde Pillwogallen in Lindenhöhe. In Pillwogallen ging Hildegard Tuttlies zur Schule und lernte ihren Mann Gerhard Kiehl kennen. In Geschäft von Hedwig Kiehl/Fritz Lerdon wurde der tägliche Bedarf eingekauft. Die Älteren besuchten die angeschlossene Gaststätte und die Jüngeren die Tanzvergnügen am Wochenende. Nebenan hatte auch der Posthalter Link seine Poststelle. Die Hebamme, die Berta Tuttlies bei den Geburten half, wohnte hinter dem Gasthof. Die Eltern von Ursel Weihnowski, der Schulfreundin von Hildegard Tuttlies, hatten in Lindenhöhe ebenfalls ihren Hof.
Pillwogallen später Lindenhöhe grenzte nord-westlich an Willschicken. Die unmittelbare Nachbargemeinde von Wilkental hatte 1939 gezählte 187 Einwohner auf 32 Höfen, 8 davon bildeten den alten Dorfkern - an der Grünheider - Aulowöhner Chaussee. Sie verläuft in der oberen Kartenhälfe von Osten nach Westen. 1939 war Lindenhöhe 230,9 ha groß.
Das Messtischblatt zeigt Teile der Gemeine Lindenhöhe. Der Dorfkern liegt an der Kreuzung der Überland-Straßen. Auf der Lindenhöher Karte sind auch acht Höfe des alten Dorfkerns von Lindenhöhe und das Kreishaus eingetragen. Darunter befindet sich das Gasthaus von Fritz Lerdon (früher Hedwig Kiehl). Fritz Lerdon, er stammt aus der Nachbargemeinde Paducken, hat 1928 die Witwe Hedwig Kiehl geb. Padeffke geheiratet. Ihr erster Mann Max Kiehl war 1921 verstorben. Gerhard Kiehl, eines der vier Kinder aus der ersten Ehe, wird 1943 der spätere Ehemann von Hildegard Tuttlies. Räumlich waren die Tuttliesen eher auf Lindenhöhe als auf Wilkental orientiert.
Fritz Lerdon besaß 1931 das erste Auto in Lindenhöhe, war Jagdpächter und hatte zwei Höfe in Lindenhöhe gepachtet. Hier lag auch sein Kolonialwarengeschäft mit Gastwirtschaft und einem Saalbetrieb der Familie Kiehl, später Lerdon. Rechts hinter und neben der Gasstätte hatte die Hebamme Mikuteit und der Chaussee-Aufseher Kuhnke ihre Höfe, die sie als Nebenerwerbslandwirte betrieben. Wendel (Altenteil) und Link (Poststelle) waren weitere Bauernhöfe im alten Dorfkern, links neben dem Gasthof, deren Land von Lerdon gepachtet war. Dazu gab es noch auf der anderen Straßenseite den Schmied Sanowitz, vier weitere Höfe und das Kreishaus von Franzdorf, der früheren Gemeinde Schruben. 1929 erfolgte die Eingliederung der Landgemeinde Schruben aus dem Amtsbezirk Keppurlauken in die Landgemeinde Pillwogallen. In Lindenhöhe lag - nahe dem Dorfkern - auch die Schule, die Hildegard Tuttlies mit ihrer Freundin Gerda Weinowski besuchten.
Die Gaststätte Lerdon und der Laden waren auch das "soziale Zentrum" vom östlichen Wilkental. Hier gab es u.a. Mehl, Zucker, Bonbons, Schmalz, Bier, Wein, Schnaps, Salzheringe, Nägel, Schrauben, Holzschlorren, Holzklumpen, Wagenschmiere, Kuhketten, Petroleum und das Neueste aus den umliegenden Dörfern. Später wurde der Laden auch Landestation für die aufkommenden Radio-Akkus.
Zur Gemeinde Lindenhöhe gibt es leider kaum GenWiki Einträge. Der nächstgrößere Ort war Grünheide. Quelle: Kirche Grünheide (Ostpreußen) – Wikipedia
- Hildegard Tuttlies und Gerhard Kiehl
Die Konfirmandin Hildegard Tuttlies (1934) [32]
Der Konfirmand Gerhard Kiehl (1928) [33]
Das Hochzeitspaar Hildegard Tuttlies und Gerhard Kiehl (1943) [34]
In Lindenhöhe waren auch auf einem leestehenden maroden Gutshof zwei Zigeunersippen seit etwa 1880 zwangsangesiedelt. Sie umfassten schätzungsweise jeweils über 20 Personen und waren sich untereinander aber nicht grün. Sie wurden von den Nachbaren und den Gendarmen kritisch beobachtet. Fritz Lerdon hatte mit den Sippenältesten jeweils "Verträge" abgeschossen, um sich gegen Zahlung einer geringen Geldmenge, vor Diebereien in seinem Laden zu schützen - was aber nicht immer funktionierte. Die Zigeuner waren aber nur im Winter sesshaft. Nach heimlichen Beobachtungen der Dorfkinder aus der Nachbarschaft durch die kaum erleuchteten Fenster wurden im Winter "Kinkerlitzchen" wie Ringe, Anhänger, Ketten, Anstecknadeln, Küchenwerkzeuge und Spielzeug von den Sippen höchst einfach herstellt. Die Dorfbewohner waren auch erstaunt, dass schon junge Frauen in der Öffentlichkeit regelmäßig rauchten - es gab aber sonst keine Kontakte zwischen den Dorfbewohnern und den Zigeunersippen, abgesehen von den Besuchen der Amtspersonen oder den notwendigen Einkäufen im Dorfladen.
Nur mit zwei ausgesuchte Bauern schacherten die Sippen regelmäßig um Lebensmittel, wie Milch, Korn und Kartoffeln - die, nach Vermutungen der Dorfbewohner - manchmal allerdings auch illegal woanders "besorgt" wurden. Dies galt besonders für Brennholz. Die zwei mit den Zigeunern handelnden Bauersfrauen zeigten sich dann in der Öffentlichkeit immer stark mit Schmuck "behängt", den sie weitertauschten oder verkauften. Sie wurden zu regelhaften "Dorfadressen" der schmuckinteressierten weiblichen Dorfjugend. Eine kleine Kette kostete damals ein Huhn oder 1 - 2 RM. Wie hoch die Gewinnspannen waren, erfuhr keiner. Besonders die von den Höfen entfernt liegenden Kartoffel- und Rübenmieten wurden im Winter von ihren Besitzern genau beobachtet. Die zahlreichen Zigeuner-Kinder gingen auch nicht in die Schule. Im Sommer zogen die Sippen, einschließlich ihrer Alten und Kranken, mit "Sack und Pack" über Land um ihre Produkte zu tauschen oder zu verkaufen, Musik gegen Geld aufzuspielen oder nach dem Kindersingen zu betteln - die Gebäuden in Lindenhöhe standen dann leer - auch die spärlichen Möbel einschließlich der kleinen Öfen wurden mitgenommen.
1938 gab es am Kreishaus in Lindenhöhe einen Aushang, dass "die schädlichen Elemente aus dem Dorf jetzt eine sinnvollen Arbeit zugeführt worden seien." Mit dem im Dezember 1937 in Kraft getretenen sogenannten "Asozialenerlaß" bekam die Gemeinden ausdrücklich die Kompetenz, Zigeuner in ein Konzentrationslager einzuweisen.
Familie Tuttlies und Paducken / Padau
Paducken war ein Scharwerks-Bauerndorf, eine Gemeinde im Kirchspiel Aulowönen. Insterburg lag 18,6 km entfernt. Am 16.07.1938 wird Paducken als Ortsteil in die Gemeinde Klein Schunkern eingegliedert, danach erfolgt die Umbenennung in Padau.
Paducken gehörte zum Regierungsbezirk Gumbinnen, Amtsbezirk Groß Franzdorf, hatte 1912 104 Einwohner und war 167,2 ha groß. Die nächste Schule lag in Pillwogallen / Lindenhöhe, das Standesamt und Gendarmerie in Aulowönen / Aulenbach. Das zuständige Landkreisamt, Amtsgericht und Bezirkskommando lagen in Insterburg, die Post in Groß Warkau. Die nächste Eisenbahn in Aulowönen, war 4 km entfernt. Die Gemeinde lag in ”Klein Litauen (Lithuania minor)" oder ”Preußisch Litauen”, dem nordöstlichen Teil des alten Ostpreußen. Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch.
Quelle: Meyer Orts- und Verkehrslexikon (1912)
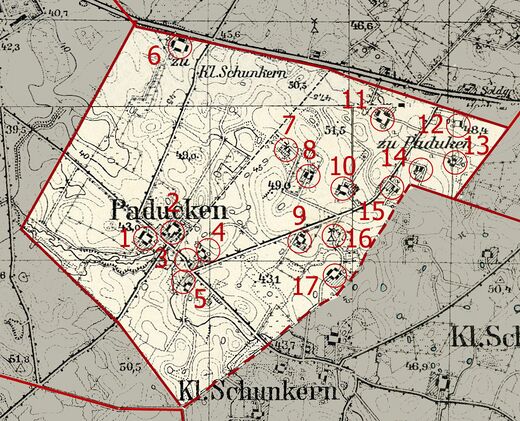
Am 3.6.1938 erfolgte die Umbenennung der Gemeinde Paduken in Padau. Aus Paducken stammten die Eltern von Berta Tuttlies, der Vater von Fritz Lerdon und die Schneiderin, die Fritz Tuttlies angelernt hat. Dort hatten die Tuttliesen überwiegend ihren Landbesitz, geerbt von den Eltern von Berta Tuttlies, den Burbas. Hier wurde auch ihr Getreide gedroschen und ihre Kartoffeln geerntet.
Paducken später Padau grenzte südlich an Willschicken und hatte 1933 gezählte 77 Einwohner.

Folgende Einwohner waren 1927 im Ortschafts- und Adreßverzeichnis des Landkreises Insterburg unter Paducken aufgeführt:
- Besitzer : Albert Burba, Friedrich Burba, Herman Donner, Gustav Erdmann, Wilhelm Lerdon, Franz Mett, Gustav Neumann, Friedrich Naties, Franz Onußeit, Karl Pallapies, Ewald Pohl, Amalie Rieser, Franz Rieser, Lina Schellwat
- Altsitzer : Wilhelm Statschus, August Brandstäter, Karoline Onußeit, Friedrich Rimkis, Henriette Ennulat
- Schneider : George Bundel, (Gertrud Kianka)
- Meierist: Fritz Naujoks
- Kätner : Wilhelm Genee
- Arbeiter : Karl Cohn, Julius Weinowski

Auf Basis der Einwohnerliste sowie der nebenstehenden Karte der Hofbesitzer/Pächter der Gemeinde Paducken (1944) konnte sich Hildegard Kiehl geb. Tuttlies an die folgenden sechs Namenszuordnungen erinnern:
- (6) Schellwat, Franz, Großbauer,
- (10) Berend, Besitzer (Lage Nähe zum Friedhof),
- (11) Burba, August, Großbauer - Vater von Berta Tuttlies, geb. Burba (siehe Tuttlies in Willschicken/Wilkental). Die Hofstellen Burba und Tuttliesen lagen in Sichtweite (nähere Informationen zum Familienstammbaun der Tuttliesen siehe oben).
- (12) Kianka, Gertrud , Schneiderin und Bundel Georg. Frau Kianka hat eng mit Ferdinand Tuttlies im Rahmen der Schneiderei zusammengearbeitet. Die Hofstellen Kianka und Tuttliesen lagen in Sichtweite,
- (13) Rieser, Franz , Bauer, Altsitzer - nach Hildegard Tuttlies war er als "Kinderscheucher" sehr bekannt.
- (14) Lerdon, Wilhelm, Bauer und Altsitzer, Vater von Fritz Lerdon, dieser war verheiratet mit Hedwig Lerdon, verw. Kiehl, geb. Podewski in Lindenhöhe (nähere Informationen zum Familienstammbaun der Kiehls siehe oben). Der Hof von Ferdinand Tuttlies in Willschicken ist auf der Karte dem "Verzeichnis der Hofbesitzer / Pächter Gemeinde Wilkental (früher Willschicken) ca. 1944" Hofkarte von Willschicken (Nr. 24) sichtbar.
Wilkental wird ab 1940 mitverwaltet vom Amtsvorsteher dem Besitzer Julius Onusseit in Klein Schunkern. Quelle: Klein Schunkern – GenWiki (genealogy.net)
Familie Tuttlies und Aulowönen / Aulenbach
Die Errichtung der Kirchengemeinde Aulowönen erfolgte im Jahr 1610. Die Dörfer Juckeln (seit 1918 Buchhof, heute russisch: Buchowo), Warkau (Schischkino, nicht mehr existent), Gaiden (Stepnoje), Alt Lappönen (Datschnoje) und Jennen (Podlesnoje, nicht mehr existent) bildeten mit Aulowönen den Kern der Siedlung, die zur Gründung des Kirchspiels führte. Das Dorf Aulowönen lag innerhalb des Kirchspiels Aulowönen. Die örtliche Kriegs- und Domänenkammer hatte bis zur Auflösung 1810 ihren Verwaltungssitz als Kammerdepartements in Lappönen, das später zu Aulowönen geschlagen wurde. Von hier aus wurden ursprünglich auch Willschicken verwaltet. Zur Geschichte von Kirchspiel und Dorf Aulowönen siehe auch als Quellen:
Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)
und Kap. 3.2.5 in Ländliche Entwicklung von Ostreußen Im%20Gebiet%20des%20späteren%20Kirchspiel%20Aulowönen%20wurde%20ab%201531%20die%20Türkensteuer%20erhoben 3.2.5 Im Gebiet des späteren Kirchspiel Aulowönen wurde ab 1531 die Türkensteuer erhoben
Aulowönen war ein Kirch- und Scharwerksdorf. Das Dorf Aulowöhnen (Aulowönen) lag in ”Klein Litauen (Lithuania minor)" oder ”Preußisch Litauen”, dem nordöstlichen Teil des alten Ostpreußen. Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch, eine eigene Kirche ist seit dem 17. Jahrhundert bekannt.
Im Laufe der Zeit gab es zahlreiche Eingemeindungen. 1912 erfolgte der Wegfall der Zusatzbezeichnung von "Groß" Aulowönen. 1928 wird das Bauerndorf Uszupönen unter Fortfall seines Ortsnamens in Aulowöhnen eingegliedert, ebenfalls schon 1925 wurde das Gut Alt Lappönen als Ortsteil von Aulowöhnen bei Fortbestand des Ortsnamen integriert. Aulowönen hatte 1905 gezählte 340 und 1939 gezählte 1049 Einwohner. Es war 1905 erhobene 364,3 ha und 1925 erhobene 1215,8 ha groß.
Aulowöhnen existiert heute unter dem Namen Kalinovka (Russland).
Bis 1945 gehörte die immerhin 44 Kirchspielorte umfassende Pfarrei zum Kirchenkreis Insterburg in der Kirchenprovinz Ostpreußen der Kirche der Altpreußischen Union. Im Jahr 1925 zählte die Gemeinde 4726 Gemeindeglieder. Der Innenraum des etwa 33 Meter langen und 13 Meter breiten Kirchgebäudes hatte eine flache, niedrige Decke. Die Emporen zogen sich um das ganze Schiff herum. Stichbogige Fenster gewährleisteten einen hellen Raum, der in Weiß und in Gold gestrichenen war. Gestühl und Bänken zeigten ein festliches Gepräge. Die Kirche in Aulowöhnen war die Tauf-, Konfirmation-, Hochzeits- und Beerdigungskirche der Tuttliesen aus Willschicken. Die Kirche wurde nach dem Krieg abgerissen, der ehemalige Standort ist heute nicht mehr erkennbar.

In Aulowönen kauften die Tuttliesen ihren höheren Bedarf ein und brachten ihr Getreide zur Verkaufsgenossenschaft. Außerdem gab es hier einen Arzt und eine Apotheke. Aulenbach besaß einen Bahnhof zur Eisenbahn-Fahrt nach Insterburg. Die Tuttliesen besuchten alle zwei Wochen fein herausgeputzt die evangelische Kirche. Hildegard Kiehl besuchte hier die Konfirmandenstunde.
Aulowönen später Aulenbach grenzte östlich an Willschicken. Aulowönen war wirtschaftlicher Mittelpunkt des gleichnamigen Kirchspiels. Die nächsten größeren Einkaufsmöglichkeiten für die Willschicker lagen es in dieser Nachbargemeinde, die etwa 5 km westlich entfernt lag. Wenn etwas nicht sofort vorrätig war, wurde es in der Regel bestellt.
Es gab Einzelhändler, Schlachter, Friseure, Schuster, Konfektionsgeschäfte, den Arzt Dr. Epha, den Tierarzt Jaeckel und den Zahnarzt (Dentist) Quidor. Folgende Firmen boten ihre Produkte an: die Adler Apotheke, die Dampfziegelei Ewald Guddadt; die Gastwirtschaft August Rautenberg, die Dampfmühle Otto Schiemann und die Ziegelei Emma Teufel, die Landmaschinenreparatur u. Pflugfabrik Karl Hertzigkeit , die Autoreparatur u. Handel Schwarznecker u. Reck und die Buchdruckerei Curt Stamm, außerdem befand sich dort die Molkereigenossenschaft, die An- und Verkaufsgenossenschaft, die Raiffeisenkasse und die Volksbank Insterburg (Nebenstelle).
Neben einer öffentlichen Schule gab es in Aulenbach auch eine 1913 gegründete Privatschule. Zur evangelischen und aber auch zur neuapostolischen Kirche kamen viele Einwohner aus den nahliegenden Ortschaften und die Gottesdienste waren stets gut besucht. Als Behörden waren vertreten das Kreis-Amt, die Gendarmerie, die Poststelle und das Standesamt. Es wurden regelmäßig Wochenmärkte abgehalten, zwei Mal im Jahr ein Pferde- (Remonten)- und Viehmarkt mit Krammarkt. Den Güter- und Personenverkehr, vor allem zur Kreisstadt Insterburg, versah überwiegend die Insterburger Kleinbahn (IKB), die hier einen größeren Haltepunkt mit Verladegleisen hatte.
- Verkaufsraum und Tankstelle Fa. Schwarznecker u. Reck, Abschrift Zeugnis von Gerhard Kiehl
Postkarte: Start eines Motoradausflug vor der Fa. Schwarznecker u. Reck von Aulowönen nach Ober Eisseln (1928)[39]
Foto: Verkaufsraum und Tankstelle Fa. Schwarznecker u. Reck - (1932)[40]
Bescheinigung: Lehrzeugnis Gerhard Kiehl der Fa. Schwarznecker & Reck (1945)[41]
In Aulenbach bei der Firma Schwarznecker u. Reck absolvierte Gerhard Kiehl eine Lehre als Maschinen-Schlosser. „Seit ca. 1926 betrieben Franz Schwarznecker und Emil Reck in Aulowönen die örtliche Kfz-Werkstatt incl. Tankstellenbetrieb. Später verkaufte sie Kraftfahrzeuge der Marken DKW und Mercedes, Landmaschinen, Fahrräder und Waschmaschinen der Marke Miele.“ Gerhard Kiehl arbeitete nach seiner Lehre noch zwei Jahre als Geselle bei der Firma Schwarznecker u. Reck. Er wurde am 01.10.1935 zur Wehrmacht eingezogen.
Familie Tuttlies und Keppurlauken / Birkenhof
Keppurlauken war zunächst ein Chatoul-cölmisch Gut im Kirchspiel Aulowönen und hatte ein eigenes Kreis-Amt, die Schule lag in Neu Lappönen und das Standesamt, die Post und die Gendarmerie in Aulowönen, 4,8 km entfernt. Das Gut hatte 1912 gezählte 31 Einwohner, 1928 waren es 199 Einwohner. Es war 1905 erhobene 117,1 ha groß. Es gehörte zum Regierungsbezirk Gumbinnen, Landkreis-Amt, Amtsgericht und Bezirkskommando lagen in Insterburg. Seine Einwohner waren nach der Reformation überwiegend evangelisch.
Quelle: Meyer Orts- und Verkehrslexikon (1912)

Ferdinand Tuttlies arbeitete auf dem Gut 1912 als Maurer kurzfristig beim Innenausbau der Gesindehäuser. Auf dem Gut Gut Keppurlauken kaufte Ferdinand Tuttlies auch für seinen Hof sein treues Pferd die "Rieke".
Die Gemeinde Birkenhof (Ostp.) war 1928 durch den Zusammenschluss von Gut Keppurlauken, Gut Neu Lappönen und dem Ort Berszienen entstanden. Die Güter lagen nord-östlich von Wilkental in ”Klein Litauen (Lithuania minor)" oder ”Preußisch Litauen”, dem nordöstlichen Teil des alten Ostpreußens, im Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.). Im Ortschafts- und Adreßverzeichnis des Landkreises Insterburg (1927) waren unter anderem folgende Einwohner vermerkt:
Gut Birkenhof gehörte dem Eigentümer Hans Regge. Es umfasste 86 ha, davon 57 ha Acker, 25 ha Weiden, 4 ha Hofstelle, 10 Pferde, 43 Rinder, davon 16 Kühe, 7 Schafe, 5 Schweine
Gut Keppurlauken gehörte dem Eigentümer Bernhard Tinschmann. Es umfasste. 117,1 ha, mit folgendem Gesinde: Schweizer: Franz Schmidt, Deputant: Eduard Krietzan, Karl Lempke, Friedrich Goerke, Gustav Maeding Kutscher: Franz Dumluck
Gut Neu Lappönen gehörte dem Eigentümer Erich Lengnik. Es umfasste 392 ha, davon 221 ha Acker, 25 ha Wiesen, 130 ha Weiden, 13 ha Holzungen, 2 ha Hofstelle, 1 ha Wasser, 55 Pferde, 240 Rinder, davon 50 Kühe, 130 Schweine, Herdbuchvieh und eine Meierei. Im Jahre 1910 lebten auf dem Gut Neu Lappönen 80 Einwohner. Es waren Gesinde, Deputanten, Schweizer und Kutscher. Am 30. September 1928 verlor das Gut Neu Lappönen seine Eigenständigkeit und wurde als Ortsteil in die Landgemeinde Berszienen, Kirchspiel Aulowönen / Aulenbach (Ostp.) eingegliedert, die zum gleichen Zeitpunkt in „ Birkenhof (Ostp.)“ umbenannt wurde.
Der Sohn von Erich Lengnik , der Züchter Oskar Lengnik, führte hier ein Privatgestüt, dass sich vornehmlich aus besonders hoch im Blut stehenden Mutterstuten zusammensetzte. Die Stute Herold wurde im Jahre 1925 in Neu Lappönen im Kreis Insterburg geboren. Herold wuchs in ihrer Geburtsstätte auf und wurde von seinem Züchter erfolgreich in Flach- und Hindernisrennen der Provinz vorgestellt. Pferd und Reiter, gleichzeitig auch sein Züchter, brachten zahlreiche Schleifen und Ehrenpreisen von diesen Einsätzen heim. Die Krönung aller Erfolge waren jedoch die Starts bei der Pardubitzer Steeplechase, dem schwersten Hindernisrennen des Kontinents. Von beiden Rennen kehrte Herold als Sieger zurück. Die Velká Pardubická oder Steeplechase von Pardubice ist ein traditionelles Pferderennen über 6.900 m, das auf der Rennbahn im ostböhmischen Pardubice in Tschechien stattfindet. Das Hindernisrennen gilt als eines der weltweit härtesten Rennen und wird seit 1874 veranstaltet, nunmehr jeweils am 2. Sonntag im Oktober. Der Parcours ist berüchtigt für die Größe der Hindernisse, nur ein geringer Teil der startenden Pferde erreicht überhaupt das Ziel.
Beim ersten Sieg im Jahre 1935 schrieb Gustav Rau:
- "Es steigert sich das Bild zu einer geradezu phantastischen Leistung der ostpreußischen Pferdezucht, vor der alle anderen Turniererfolge verblassen, zumal die ostpreußischen Pferde auch alle anderen Militarys in diesem Jahre gewonnen haben."
Und im Jahre 1936 berichtete Reitsportzeitschrift St. Georg anlässlich Herolds Folgesieg zur Pferdezucht auch dem Gut Neu Lappönen:
- "Jede Rennbahn verlangt ihre besonderen Pferde; Pardubitz braucht neben gewaltigem Springvermögen Pferde, die in jedem Boden zu gehen vermögen, und Pferde mit einer außerordentlichen Ausdauer. Die Strecke beträgt 6.900 m. Der Boden wechselt zwischen Rennbahngeläuf, Heide, abgeerntetem Feld und Sturzacker, verlangt also Pferde, die immer wieder kommen und ihre Aktion behalten….Es ist geradezu phantastisch, was die ostpreußische Zucht für die Große Pardubitzer seit 1923 an Siegern hergegeben hat … Diese gehäuften Siege ostpreußischen Blutes in einem Rennen wie der Großen Pardubitzer sind wohl das Bemerkenswerteste, was die ostpreußische Zucht an großen Leistungen aufzuweisen hat." So wurde Herold zum strahlenden Botschafter einer weltweit berühmten Leistungszucht der ostpreußischen Warmblutzucht Trakehner Abstammung. Von der wertvollen Neu Lappönen Zucht hat nur wenig das Kriegsende überstanden: Paloma von Hendrik (von Nana Sahib x), Pandura von Damian und ihre Tochter Palme von Port Arthur sowie Luckchen von Cornelius mit ihrer Tochter Luci von Löbau kamen auf dem Treckwege nach Westdeutschland. Ihre Stämme bewegten sich immer auf sehr schmalem Grat und tun es noch."
- Trakener Stuten
Stute Herold aus der Zucht Erich Lengnik[43] Hildegard Tuttlies mit den Enkeln Manfred und Carlhorst und der Trakener Hof-Stute Rieke [44]
Die Stute "Rieke" auf dem Tuttlieser Hof stammte auch von einer "Nebenlinie" der Neu Lappönener Zucht ab. Sie war bei einer Remonte-Prüfung auf dem Gut ausgemustert worden und konnte so dort von Ferdinand Tuttlies als "Dreijährige" preiswert erworben werden. Zu Hause galt sie als treu und leistete hervorragende Dienste. Trotzdem waren durchreisende Pferdehändler an "Riecke" sehr interessiert. "Sie ist doch noch für eine Privatzucht hervorragend". Ferdinand Tuttlies hatte später kurzzeitig beim Innenausbau der Gesindehäuser auf dem Gut gearbeitet.
Platt im Willschicken: Kupst und Kaddig

Die zwei Millionen Ostpreußen brachten ihre Traditionen in vielfältiger Form im Fluchtgepäck in die BRD und DDR mit. Das gesprochene ostpreußische Platt ist heute 2023 nahezu ausgestorben. Auf alten Tonträgern und im Internet lassen sich noch winzige Sprachinseln entdecken. In der Literatur sind noch einige Erinnerungen zu finden.
Quellen:
Onser Platt – Kreis Gumbinnen (kreis-gumbinnen.de)
Ton-Kassette Ostpreußisch Platt - Deutsche Digitale Bibliothek (deutsche-digitale-bibliothek.de)
Mediathek Audiosammlung - Landsmannschaft Ostpreussen e.V.
ländliche entwicklung in ostpreußen - Suchen Videos (bing.com)
In Willschicken wie in weiten Teilen von Ostpreußen sprachen die ländlichen Bewohner platt. Das Platt war mit litauischen Sprachteilen durchsetzt
Von den übrigen ostniederdeutschen Dialekten unterscheidet sich das Niederpreußische in Ostpreußen vor allem durch viele Gemeinsamkeiten in Phonetik, Grammatik und Wortschatz mit dem Hochpreußischen. Einige wichtigen Merkmale des Ostniederpreußische sind nach W. Ziesemer [46] und dem Preußischen Wörterbuch [47] :
- Die plattdeutschen Infinitive haben meist ein (n); dieses gilt für die Aussprache in Westpreußen, während in Ostpreußen das Schluss-n weggelassen wird (Sie will gehen - Sö wil goh)
- Beibehaltung des ge- im Mittelwort (Hei is lopen; dagegen Ostniederdeutsch: He is jelope)
- Entrundung (Kenig, Brieder, Fraide, Kraiter für Standarddeutsch Könige, Brüder, Freude, Kräuter)
- Doppellaut mit Dehnung ai statt ei, eu, äu
- Vorliebe für Verkleinerungssilben (De lewe Gottke und hochpreußisch kommche, duche, Briefchedräger) – umlautlose Verkleinerungsformen (Hundche, Katzche, Mutterche)
- „nuscht“ für Standarddeutsch „nichts“ (Färe Dittke nuscht - für einen Groschen nichts)
Es folgt ein Auszug aus: Lituanismen im Ostpreußischen – Sprache und Alltag in Nord-Ostpreußen. [48]
- Analysiert wird im Folgenden eine Auswahl von Texten, die nach 1945 in Form deutschsprachiger Buchpublikationen erschienen sind. Es mag erstaunen, dass auch noch nach über 50 Jahren - im Jahr 2000 nach Vertreibung und Flucht der Bevölkerung das ostpreußische Spracherbe, niederdeutsches Platt, in der Mundartforschung auch als niederpreußisch bezeichnet, in dieser Lebendigkeit in den Texten vorliegt.
- Bei nicht seltenen deutsch-litauischen Missverständnissen ist oft zu hören: "Ei, was is dat? Ich versteh nich Litauisch. Mußt Daitsch mit mich kalbeken."
- Um es vorwegzunehmen: der in Ostpreußen wohl am häufigsten verwendete Lituanismus, alltagssprachlich, wie auch im Schrifttum, ist die Bezeichnung Margell, Marjellchen, Jungensmargell, Burmargel (pltd.), u. ä. Wenn es darum geht, die äußere Erscheinung und bestimmte Eigenschaften von Mädchen allgemein und von Dienstmädchen zu charakterisieren, kann der ostpreußische Sprachschatz aus dem Vollen schöpfen “Dat es e abjefeimte (oppjeplusterte, fijuchlige, filistrije, freche, jedreiste, krätsche) Marjell“ . Ist ein Mädchen grasze (rundlich, schön genährt), dann gilt sie als besonders angriepsch . Typisch ostpreußisch klingt der Satz „Margell, bring e Kodder, eck häbb Schmand verschmaddert“ . Ähnlicher Beliebtheit erfreut sich das Lieblingsschimpfwort der Ostpreußen, die Bezeichnung Lorbas, kurz gesagt, Lümmel. Fast durchgehend findet man in den Texten die litauischen Nationalspeisen Schuppnis und Kissehl und auch die Schaltnoosen genannt, die in Ostpreußen auch unter der deutschsprechenden Bevölkerung verbreitet waren. Die meisten Begriffe werden im Zusammenhang mit Gegenständen des Alltags, bestimmten Tätigkeiten, sozialen Handlungen und allgemeinen Lebensumständen verwendet.
- Da ist zunächst der Turgus , der Wochenmarkt (in Aulowönen), in der weitgehend von agrarischen Lebensverhältnissen bestimmten Umwelt, ein Zentrum der Kommunikation und des Austausches von Waren, Kontakten und Nachrichten, zu nennen. Auf den Wochenmärkten spielt sich das Leben ab, es sind kleine Volksfeste, alles war auf den Beinen. Und hier trafen sie sich, der fast nur litauisch sprechende Bauer mit dem jüdischen Händler und dem deutschen Handwerker. Vielleicht gesellte sich auch noch ein polnischer Tagelöhner dazu. In dem mehr oder weniger direkten Kommunikationsprozess spiegeln sich verschiedene Ethnien und die ostpreußische Sprachenlandschaft wider: der freche Lorbas , der schwachköpfige Glumskopf und der muntere Bocher , bilden eine Gruppe von Gerkgesellen , deren Geseier und Gejacher über den ganzen Markt erschallt.
- Neben dem Wochenmarkt und der Kirche war auch der Krug (Gasthofas) häufig mit Kolonialwaren Geschäft, das soziale Zentrum der Dorfbewohnen, wo sich die Männer nach Erledigung ihrer Arbeit zu treffen pflegten, um dort in geselliger Herrenrund a Tulpche Bier oder a Konus zu trinken und sich untereinander auszutauschen. Nun, bei nur einem Schnaps oder einem Glas Bier ist es selten geblieben, denn sobald einer der Herren eine Tischrunde „schmiss“ (ausgab), war es für die anderen doch Ehrensache, es ihm gleichzutun!
- Zum Turgus eilten auch Frauen mit dem Kreppsch (Korb) oder Turguskorw in den Händen. Dabei achteten sie besonders auf den Inhalt ihrer Kischenne (Geldtasche), die sie mit dem Dirschas (Riemen, Gürtel) unter der Marginne , dem zweiteiligen Rock, befestigten. Ihre Kicke (Kopfbedeckung verheirateter Frauen), die schon ganz aus der Mode geraten waren, ließen sie zu Hause. Unterwegs wurden sie von einem Schwauksch (Regenschauer) überrascht. Auch die Tochter wollte zum Markt (... „palauk man bißke“... ); sie wollte sich nur noch die Parreskes anziehen. Die Mutter war in Eile (... „nu paspek man bißke“... ). Sie gab der Tochter gleich den Rat mit auf dem Weg, sie möge ihren Bambas (Nabel) nicht herausspeilen, sonst würden ständig die Bowkes auf sie glupen.
- Über den Marktplatz verteilt standen Buden, kleine Häuschen, in denen gewöhnlich Handel getrieben wurde, oder es wurde direkt von den unzähligen Pferdewagen aus gehandelt. Zum Transport mag der Dwirratsch gute Dienste geleistet haben, ein dem Bauern nützlicher zweirädriger Einspänner, der so leicht war, daß er auch von Menschen gezogen werden konnte. Es handelt sich um einen leichtgängigen Wagen mit verhältnismäßig großen Rädern, die auch bei schlechter Straße und unwegsamen Gelände ihren Dienst nicht versagten. Beim Transport kleiner Güter über kurze Entfernungen war dieses Gefährt unentbehrlich.
- Gehandelt wurde mit allem: unter den Tieren sind es die Ante (Ente), Trusch (Kaninchen), Kujjel (Eber), Ramunde (Pferd), und die störrische Zibb (Ziege), die den Vorbeigehenden einen Stums (Stoss) gab. Aus Fässern wurden Zillkes (Heringe) und der Kapustes (Kohl), den man bald nicht mehr riechen konnte angeboten, nicht zu vergessen den litauischen Suris (Käse). Auch Kruschkes (Birnen) waren genug da.
- Der Fischhändler hatte sicher auch den Puke (Kaulbarsch) im Angebot. Man musste aufpassen, denn das war ein echter Kupschus (Händler - negativ). Wurde man unter Männern handelseinig - besonders nach abgeschlossenem Vieh- oder Pferdekauf - dann traf man sich zum Margrietschtrinken . Hier wurde so mancher des anderen Draugs (Freund), über den man nichts mehr kommen ließ. Bei diesem Umtrunk, mit dem man das Geschäft besiegelte, blieb es nur selten bei einem Glas. Umzech (Umzechen) hieß das Trinken „der Reihe nach“, sozusagen im Kreise herum. Das übliche Maß war der Puske , die Hälfte der Halbliterflasche. Bummchen (auch Bommchen) hieß ein altes Branntweinmaß an der Theke. Es mangelte nicht an verschiedenen Schnapsarten: Degtinnis, Brantewin, Kornus, Peperinnis, Pfefferschnaps, auch Pipirskis genannt, Skaidrojis , reiner, klarer aus Roggen oder Kartoffeln gebrannter Schnaps mit 56 Volumenprozenten („Dat öss dat reine Wort Gottes“ ) und - nicht zu vergessen - der Meschkines , auf Deutsch Bärenfang (pltd. Boarefang)
- Den Stellenwert des Schnapses im Bewußtsein und wohl auch im Alltag der ostpreußischen Bevölkerung zeichnen zwei verbreitete Sprüche: „Schnapske mott sön, Brotke, wenn sön kann“, „Vor’m Schnaps e Schnaps und nach’m Schnaps e Schnaps“. Die Geräuschkulisse - ein ohrenbetäubendes Stimmengewirr in den verschiedensten Sprachen und Dialekten, noch verstärkt durch das laute Rufen der Händler, und das Rauloken (Brüllen) des Viehs - bildet jenen Hintergrund, in dem von kalbeken die Rede ist, was nicht nur viel und laut reden, sondern auch dumm und weitschweifig streiten und zanken bedeuten kann, echtes Jebroasch (pltd.) Der Kalbeker und die Kalbekersche gelten allgemein als geschwätzige und zänkische Personen. So mancher hatte die Kalbekerei all satt , da viele sich eh nur halbwortsch (pltd.) verständlich machen konnten.
- Die gemeinsamen Angelegenheiten (...“Wenn nu wat em Därp to beräde un to beschlute weer“... ) regelten die Bauern auf der Dorf - oder Gemeindeversammlung, Krawuhl oder Pulkus . Der Dorfschulze oder Bürgermeister ließ in manchen Gegenden die Krebulle oder Kriwulstock mit dem Krawuhlzeddel , auf dem Ort und Zeit der Versammlung vermerkt waren, von Hof zu Hof tragen. Hier handelt es sich um eine traditionelle Form der Kommunikation innerhalb der dörflichen Selbstverwaltung. (Diese Möglichkeiten der Landgemeindeordnung wurden 1927 durch das Gemeindereformgesetz abgelöst.)
- Auch die geselligen Treffen der Jugend wurden Krawuhl genannt, doch gewöhnlich hießen solche Zusammenkünfte mit Tanzvergnügen Wakarelis (geselliger Abend). Neben der Ziehharmonika und dem Trubas als Begleitinstrumente, erklangen hier nicht selten litauische Dainos . Dieser Art von Lustbarkeit des litauischen Gesindes, bei dem auch der Schnaps nicht fehlte -genannt Schwentadene -, galt der deutsch-litauische Spottvers: „Huste-pruste, Heiserkeit! –Dewe dok verjniechtes Leben“ . Hier fand auch der Jurrai , der jeden Abend mit einem anderen Marjell erschien, sein Betätigungsfeld, wofür sie ihn Herzensbrecher, Landbeschäler, Deckhengst schimpften. Den dörflichen Don Juan nannte man Jemeideerpel . Für einen Butsch mußte man erst ein Mädchen finden und beim Streit unter jungen Männern wechselte so manche Dauksche (Ohrfeige) die Seite.
- Doch das Leben bestand nicht nur aus Feiern und geselligem Beisammensein, im Vordergrund stand oft harte Arbeit. Verbreitet war die Talka die freiwillige, gelegentlich auch erbetene Hilfe unter den Nachbarn. Eine Talka fand zu verschiedenen Anlässen statt: während der wichtigsten Feld- und Erntearbeiten, wie Heu- und Getreideernte, der meist intensiven nächtlichen Flachsarbeit in der Jauje (Dreschtenne) oder Pirte (Badstube) und zu kleineren Anlässen, wie bei der gemeinsamen Schlachtung, genannt Skerstuwiß. Skerstuwiß bedeutet zweierlei: die Schlachtung selbst und der darauffolgende Schmaus der Beteiligten und auch der Nachbarn.
- Die Talka half so manchem Bauern eine Notlage zu überbrücken; wenn z.B. eiligst das Getreide eingefahren mußte, aber gerade im Moment wegen Krankheit „Not am Mann“ war, nahm der Nachbar seinen Dwiszak (hölzerne Forke) in die Hand und eilte dem Nachbarn zu Hilfe. Größere Vorhaben, wie Hausbau, war ohne Hilfe von außen nicht zu leisten. Bei der Talka war eine Bezahlung in Form von Geld nicht üblich und wurde auch nicht erwartet, daher stand die Abschlussfeier mit großzügiger Beköstigung und reichlich Schnaps im Vordergrund.
- Für die Bewirtung war die Frau des Hauses, vom Gesinde auch Herzmutter oder Herzfrauchen genannt, zuständig. Von Jurgin (23.April) bis Micheel (29. September) wurde das Vesper gereicht. Zu Essen - zum Launagies (Vesper) oder Becktuwes, Pabaigtuvis (Abschlussfeier) - gab es reichlich: weder das gute Stück, der Kampen, Schwarzbrot, noch die beliebte Bartschsuppe (pltd.Boartscht), im Sommer auch kalt mit dem Scheppkausch serviert, durfte fehlen. Der Druskus (Salz) zum Abschmecken lag immer bereit. Bei guter Arbeit nahm die Wirtin den Skilandis (Schwartenmagen) vom Lentin, dem sie mit dem Peilas (Messer) zu Leibe rückte. Die Wirtin war ständig in Bewegung, mal eilte sie zur Klete (Speicher), um einige Pagels (Holzscheite) zu holen, damit die Pliete (Kochherd) nicht kalt wurde, mal rannte sie mit dem Peed (Wassertrage) zum Brunnen, um frisches Wasser zu besorgen. Nach dem reichlichen Essen und einigen Schnäpsen lehnte sich so mancher zurück zum behaglichen Rangieken (krümmen).
- Für die Frau des Hauses war hierfür keine Zeit. Die Sorge um Haushalt und Tiere nahm sie voll in Anspruch: das Schweinefutter mußte mit dem Mentas (Rührholz) gerührt, die Edzs (Futterraufe) mit Futter gefüllt werden. Und dann noch der Ärger mit der Rankin (Griff) am Brunnen, die ständig herabfiel und dem Nachbarn, der vergaß den Karnelis (Handkarre) zurückzubringen. Selbst feiertags hatten sie keine Zeit zum Ausruhen, mußte ständig irgendwas Krapschtieken (wühlen, kramen, herummurksen) und Krausticken (umräumen). Kein Wunder, dass ihr nach all dem Ungemach ein Dokschpakajus (gib Ruhe!) über die Lippen kam. Zum Glück spielte ihr der Kauks kein Schabernack und auch vom Perkun (Donner) blieb das Haus verschont.
- Begräbnisse gehörten zu den Ereignissen, an denen die ganze Dorfgemeinschaft beteiligt war. Zum Zarm (Leichenschmaus) wurde ordentlich aufgefahren, denn meistens wurde eine standesgemäße Bewirtung der Trauergemeinde erwartet. Jede Gemeinde hatte ihren eigenen Friedhof. - so auch Willschicken. Die Gräber ( Kapas ) waren gepflegt, die Bepflanzung natürlich dem Klima entsprechend, d.h. für den Sommer setzte man Blumen, doch für den Winter deckte man die Grabstellen nur mit Tannengrün und einem Grabgesteck ab. Während der warmen Jahreszeit ging man an jedem Samstag auf den Friedhof, ( Kapinės ) brachte einen frischen Blumenstrauß hin und harkte den Boden um das Grab herum. Die alteingesessenen Einwohner nannten ganze Grabreihen ihr Eigen, die für sie auch immer reserviert blieben. Manche waren durch kunstvoll geschmiedete Zäune wie eine kleine Oase vom übrigen Teil abgegrenzt. Ganz alte Gräber dagegen hatten noch keine Grabeinfassung. Da wurden die Grabhügel nur durch immergrüne Bodendecker gehalten.
- Die ostpreußische Kultur- und Sprachenlandschaft erinnert an einen bunten Flickenteppich auf dem sich in historischer, geographischer und sozialer Dimension verschiedene Ethnien, Deutsche, Litauer, Polen und Juden, in einem mehr oder weniger direktem Kommunikationsprozess, dem Land jene Farbe gaben, durch das es sich auszeichnet. Selbst unter der deutschsprechenden Bevölkerung gab es, was die Verwendung von Sprache betrifft, einen Riss: platt (ostpreußisches Niederdeutsch) sprach das Volk, hochdeutsch die „feinen Leute (Ärzte, Pfarrer, Lehrer)"
Auch die weiteren Texte von Gerhard Bauer in den Annaberger-Analen über Preußisch Litauen sind sehr lesenswert (Jahrgang 11, 13-15, 17, 18, 20 und 21). Die Annaberger-Analen sind nach 30 Jahren 2022 leider eingestellt worden. [6]
Etwa 13 Hofbesitzer im Willschicken trugen Namen mit litauischem Ursprung. Bis auf einen Gutsbesitzer und zwei Großbauern, die jeweils zugezogen waren, sprachen alle Dorfbewohner Platt. Nur wer sich in der Öffentlichkeit besonders hervortun wollte, verfiel zeitweise ins Hochdeutsche. Die ältere Generation hatte zum Teil noch den litauischen Konfirmationsunterricht in Aulenbach (Ostp.) besucht. Ab 1900 nahm der litauische Sprachgebrauch in Ostpreußen aber deutlich ab. Bis dahin wurde in einigen Dorfschulen in der Pilkaller und Gumbinner Gegend auch noch Litauisch gelernt. In der Dorfschule sollte nach den Schulkonferenzen in Preußen 1890 und 1900 in ganz Ostpreußen grundsätzlich Hochdeutsch gesprochen werden. Doch in manchen Alltagssituationen fielen gerade die kleinen Schüler wieder in ihr von zu Hause gewöhntes Platt zurück.
In der Lindenhöher Dorfschule wurde ab der 1. Klasse Hochdeutsch als Schriftsprache auf der Tafel mit einem Griffel geübt. Edeltraut Tauchmann geb. Schlack berichtet aus der Nachbargemeinde von Waldfrieden (Ostp.):
- Zu den Utensilien eines ABC-Schützen gehörten neben Fibel und Rechenbuch eine Schiefertafel mit Schreiblinien auf der einen und Rechenkaros auf der anderen Seite. Seitlich waren an zwei langen Bändern ein Schwämmchen und ein Lappen befestigt oder aus Kostenersparnis auch nur zwei Lappen. Auf jeden Fall hatte eines der beiden immer feucht zu sein, um damit das Geschriebene fortwischen zu können. Mit dem anderen schnell trockengewischt, war die Tafel dann gleich wieder einsatzbereit. Der Lehrer überprüfte hin und wieder die Feuchtigkeit des Schwammes/Lappens, aber wenn er nicht hinsah, tat's auch Spucke, und bei einem einzelnen Buchstaben war der schnell im Mund nass gemachte Finger sowieso präziser einzusetzen. Außerdem fingen die feuchten Wischer bald an zu stinken - eine wirklich unhygienische Sache! - und mussten durch neue ersetzt werde. Geschrieben wurde mit einem Griffel aus Schiefer. Er war etwa so lang wie ein Bleistift, aber dünner, und da er keine Holzummantelung besaß, war er leider nicht bruchsicher. Angespitzt wurde er mit einem scharfen Messer, aber verständlicherweise nur von Erwachsenen. Deshalb war es ratsam, morgens gleich mehrere gut angespitzte Griffel in seinem hölzernen Griffelkasten zu haben, die dann beim Laufen vernehmlich im Tornister (Schulranzen) klapperten, während die beiden seitlich heraushängenden Läppchen - oft im Verein mit den Zöpfen - lustig hinterher flogen. In der zweiten Klasse begannen wir, Bleistift und Hefte zu benutzen, in der dritten Federhalter und Tinte. [7]
Berta und Ferdinand Tuttlies sprachen in Willschicken mit ihren Eltern noch fließend Litauisch - die Kinder - wie Hildegard Tuttlies - verstanden noch Teile, sprachen es aber nicht mehr selber - Platt dagegen sprach noch die gesamte Familie. Siehe auch den Text von Hildegard Kiehl, geb. Tuttlies Willschicken - Erinnerungen, Flucht und Neuanfang. Der litauische Name Tuttlies heißt übersetzt Wiedehopf.
Das Soldatengrab aus dem 1. Weltkrieg
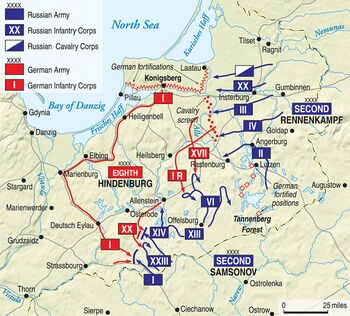

Bereits 2 Wochen nach Beginn 1. Weltkrieges am 01. August 1914, fiel Russland schneller als erwartet in Ostpreussen ein. Vom August 1914 bis zum Februar 1915 waren bis zu zwei Drittel Ostpreußens zeitweise russisch besetzt. Die zweimal durch Ostpreußen ziehende Frontlinie hinterließ durch die Kampfhandlungen ein zerstörtes Land. Traurige Höhepunkte waren die Schlachten bei Stallupönen (17. August 1914, Gumbinnen 19.-20. August 1914), Tannenberg (23.-31. August 1914) und Masuren (07.-16. Februar 1915).
In der kaisertreuen Presse wurde Paul von Hindenburg als Sieger von Tannenberg und Befreier von Ostpreußen gefeiert, im Volk gewann er eine hohe Popularität. Im Ersten Weltkrieg übte die von ihm geführte Oberste Heeresleitung nach diesem Erfolg von 1916 bis 1918 praktisch eine diktatorische Regierungsgewalt aus, der sich der Kaiser unterordnete. Die deutsche Niederlage im ersten Weltkrieg begründete er später mit der sogenannten [Dolchstoßlegende].
Bereits 1914 setzte man eine Kommission ein, welche die Verluste in Ostpreußen protokollieren sollte. Für die Gesamtprovinz belief sich der Schaden auf 1,5 Milliarden Mark. Etwa 1.500 Zivilisten waren der Besatzung zum Opfer gefallen. Insgesamt kamen während der Kämpfe 1914/15 über 61.000 Soldaten ums Leben – 27.860 Deutsche, 1.100 Österreicher sowie 32.540 Russen. Dramatische Auswirkungen zeigte der Verlust an Vieh und Pferden, der die Versorgung ernsthaft gefährdete. Viele Menschen hatten während der russischen Besetzung in ihren Dörfern ausgeharrt oder waren auf der Flucht von russischen Truppen überrascht worden. Auf ‚Spionageverdacht‘ hatten die Besatzer gnadenlos reagiert, es war zu zahlreichen Exekutionen gekommen. … Insgesamt wurden bis zu 13.000 Zivilisten nach Russland deportiert.[51]
Mutter Berta Tuttlies blieb 1914/15 mit vier Kindern zu Hause. Hildegard Tuttlies spätere verh. Kiehl wurde erst 1920 geboren. Sie berichtet:
- In Willschicken stand im August 1914 die russische Militärverwaltung vor der Tür von Mutter Tuttlies und suchte Unterkünfte für verwundete russische Soldaten in der Umgebung. Das Wohnhaus musste geräumt werden und Mutter Tuttlies und ihre vier Kinder zogen zuerst in die Scheune, nach zwei Wochen auf den Dachboden des Wohnhauses. Die Küche durfte nach Absprache weiter benutzt werden. Anfang September 1914 wurde ein schwerverwundeter russischer Soldat in das Wohnhaus gebracht, der bald darauf verstarb. Beim Abräumen des Sterbelagers durch Mutter Tuttlies standen plötzlich zwei russische Soldaten mit dem Gewehr im Anschlag vor ihr. Erst die Rufe von anderen Verwundeten „Rotes Kreuz Haus, Rotes Kreuz Haus“ bewegte die Soldaten, sich zu entfernen. Vermutlich waren sie auf der Suche nach Wertgegenständen oder Alkohol. Der verstorbene Soldat wurde von der russische Militärverwaltung etwa 20 Meter vom Wohnhaus entfernt beerdigt, am Rand des Grabens der Grünheider Straße. Am Ende des 1. Weltkriegs kam Vater Tuttlies gesund nach Hause. Das Soldatengrab wurde nach Abzug der Russen 1915 durch die Familie gepflegt. Es erhielt ein kleines Holzkreuz mit der Inschrift: „Hier ruht ein unbekannter russischer Soldat“ und einen Staketenzaun mit einer gezimmerten Tür. Zunächst wurde das Grab durch vier hohe Pfosten gesichert. Die Kinder waren für das Unkraut verantwortlich.
Zum 1. Weltkrieg siehe auch den separaten Text „Ländliche Entwicklung in Ostpreußen am Beispiel des Dorfes Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.)“
So, das war der erste Teil, aufgeschrieben von Klaus Kiehl. Er entstand aus den zahlreichen früher erzählten Erinnerungen von Hildegard Kiehl, ihren Geschwistern, weiteren Verwandten und Bekannten und deren hervorgekramten und überlassenen Notizen. Ein besonderer Dank gilt Herrn und Frau Mattulat aus Willschicken. Sie haben dankenswerterweise wichtige Eigenarbeiten zur Verfügung gestellt.
In der Hoffnung, dass alle Angaben und Quellen richtig eingeordnet sind, sind Berichtigungen und neue Informationen herzlich willkommen. Bitte senden Sie diese an Klaus-Kiehl@t-online.de
Willschicken - Erinnerungen, Flucht und Neuanfang
Hier beginnt der zweite Teil, aufgeschrieben von Hildegard Kiehl, geb. Tuttlies in Hamburg.
Hildegard Kiehl wurde am 21. März 1920 in Willschicken in Ostpreußen geboren und ist am 19.06.2021 in Hamburg verstorben. Ihre Ahnentafel ist zu finden unter: https://gedbas.genealogy.net/person/ancestors/1341029087
Zum Weihnachtsfest 2006 schrieb sie einen langen handschriftlichen Artikel ausgestattet mit 50 Fotos und Abbildungen über ihre Heimat als Weihnachtsgeschenk für ihre Enkel auf. "Anna Lena und Simon (die Enkel) sollen wissen, wie es bei uns zu Hause in Ostpreußen war."
Hildegard Kiehl, als langjähriges Mitglied der Insterburger Heimatgruppe Hamburg, hatte bei den Gruppentreffen immer viel aus ihrer Jugend zu erzählen und dazu über die Jahre dazu noch etwa 14 kleinere Artikel verfasst. Sie wurden teilweise auch im Insterburger Brief veröffentlicht. Zu Hause waren auch ihre Enkel gespannte Zuhörer.
Im Herbst 2020 schrieb sie, während der Corona-Zeit, im Alter von 100 Jahren, auch noch ergänzende Teile für den, aus ihren verschiedenen Artikeln entstandenen, nachfolgenden längeren Text auf. Die dortigen Fotos und Abbildlungen wurden ebenfalls übernommen. Dazu kommen noch kurze Einschübe. Die Themen der Einschübe basieren auf den viele Nachfragen zu den Erinnerungstexten von Hildegard Kiehl - z.B.: „ Mussten alle Mädchen in das Pflichtjahr? Was bedeutet das Wappen von Interburg? Konnten alle fliehen? Wie war das mit den Polen in Vennebrügge?“
Erinnerungen
Wie steht es allgemein mit den Erinnerungen? [52]
Erinnerung ist das gedankliche Wiedererleben früherer Erlebnisse und eigener Erfahrungen. Sie enthalten meist Bilder oder Szenen mit Landschaften, Tageszeiten und Gegenstände, mit Sprachen, Geräusche oder Temperaturen, auch Gerüche und Hautkontakte, vor allem aber Gefühle. Ereignisse, die sich aus verschiedenen Erinnerungen zusammensetzen und die man häufig und ähnlich erlebt hat, verschmelzen mit der Zeit und lassen sich dann oft nicht mehr als einzelne Erinnerung abrufen. Etwa, wenn Hildegard Kiehl von "zu Hause" spricht
Ein Kontrollprozess im Gehirn wählt aus, welche der aktuellen Wahrnehmungen überhaupt zum Kurzzeitgedächtnis und welche weiter zum Langzeitgedächtnis gelangen. Das Erlebnis ist ein Ereignis im Leben eines Menschen, das sich von seinem Alltag so sehr unterscheidet, dass es ihm im Langzeitgedächtnis bleibt. "Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie der freche Junge meinen Zopf ins Tintenfass gesteckt hat."
Als Erfahrung bezeichnet man die durch Wahrnehmung und Lernen langfristigen erworbenen Kenntnisse und Verhaltensweisen. Ein vergangenes Erlebnis, durch die eigene Erfahrung rückwirkend betrachtet, kann die aktuelle Erinnerung steuern. "Heute würde ich es auch anders machen".
Entscheidend sind daher die subjektive Einordnung und Bewertung der Ereignisse, wie z. B. in der Heimat, während des Krieges, auf der Flucht und der Neuanfang. Positive Erinnerungen überwiegen im Normalfall im Langzeitgedächtnis. Negative Situationen werden vom Langzeitgedächtnis meistens nur begrenzt gespeichert und erinnert oder sie werden "verdrängt". Das gilt vor allem für extrem wahrgenommene Situationen wie der gewaltsame Tod von Angehörigen während des Krieges oder wie erlittenen Vergewaltigungen während der Flucht.
Erinnerungen stammen aus dem Langzeitgedächtnis, das bei Personen sehr unterschiedlich ist. Es nimmt in der Regel mit dem Alter ab, das Tempo ist aber unterschiedlich. Bei Hildegard Kiehl konnten die eigenen noch vorhandenen Aufzeichnungen, aber auch Gespräche und mündliche Rückfragen, von ihr gelesene Bücher, alte Fotos und gemeinsam gesungene Lieder helfen, sich an vergangene Erlebnisse zu erinnern. Werden Erinnerungen über Generationen hinweg nur mündlich weitergegeben, können sich die Inhalte verändern. Schriftlich aufbewahrte und öffentlich zugängliche Erinnerungen sind daher sinnvoller.
Zu Hause in Willschicken

2. v. links Hildegard mit ihrem Freund dem Ziegenbock Mäck
(ca. 1925) Willschicken, Ksp. Aulenbach [53]
- Im März 2020 wurde ich 100 Jahre und genau vor 100 Jahren in Willschicken geboren. Aufgewachsen bin ich auf dem Lande in einem warmen Nest; in keinem Heuhaufen, sondern auf einem Bauernhof, mit drei Brüdern und einer Schwester. (Max, Friedel und Erich - der jüngste Bruder Otto ist schon mit 3 Jahren verstorben).
- Unsere Eltern haben uns mit viel Liebe und Fürsorge erzogen. Meine Spielgefährten waren alle Tiere, die ein Bauernhof besitzt. Meinen kleinen Ziegenbock, meinen Mäck, darf ich nicht vergessen. Er folgte mir auf Schritt und Tritt und ich tobte mit ihm um die Wette — besonders im Blumengarten, wenn dieser sauber hergerichtet war. Zur Freude meiner Mutter!! Ich war damals noch keine 5 Jahre alt, mein Mäck höchstens ein halbes Jahr alt. Für meine älteren Geschwister war ich stets die Kleine, sie behielten mich immer am Auge, soweit es ging. Nur wenn ich bei Lux, unserem Hofhund in seiner Hütte saß und mich nicht meldete, wenn ich gerufen wurde, waren sie etwas besorgt.
- Knappe 10 Minuten Fußweg von uns entfernt war mein Ehemann (Gerhard Kiehl) daheim. Seine Eltern besaßen ein Kolonialwarengeschäft mit Gastwirtschaft und einen kleinen Saalbetrieb. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich einmal dazu gehören werde! Aber mein Vater ging gerne dort hin. Überhaupt, wenn ein großes Treffen der bekannten Bauern aus der Umgebung war, am Tage der Schweineablieferung in Grünheide auf dem Bahnhof. Alle Bauern kehrten dann ( ...die Fuppen voller Geld, es war der Erlös für die Schweine) zum Umtrunk bei meinen Schwiegereltern in Pillwogallen ein.

- Pillwogallen kommt aus dem Litauischen und heißt deutsch: „Bauchende". Das gefiel den Einwohnern schon lange nicht. Auf Sondergenehmigung des Landrates Insterburg wurde der Name schon 1928 in „Lindenhöhe" unbenannt! Dort wurde der Insterburger Reiterschnaps ausgeschenkt. Ein Stück Würfelzucker und zwei ganze Kaffeebohnen wurden zerkaut und mit einem Korn nachgespült. Oder es gab einen Pillkaller. Wieder ein Gläschen Korn mit einer Scheibe deftiger Leberwurst mit einem Klacks Mostrich drauf! Vater kam dann reichlich verspätet nach Hause — aber stets lustig!
- Opas (Gerhard Kiehl) zuhause war ein Kolonialwaren Geschäft mit Gastwirtschaft (später bekannt als Gasthof Fritz Lerdon, Lindenhöhe), und dort kauften alle Bewohner im weiten Umkreis ein. Es gab fast alles, was das Herz begehrte. Mehl, Zucker, Bonbons, Schmalz, Kuhketten, Holzschlorren, Klumpen, Bier , Wein, Alkohol, Wagenschmieren und Salzheringe. Sie lagen in einem großen Fass in Salzlake. Das Holzfass stand gleich hinter der Ladentür, darüber ein großer Stapel Packpapier als Einwickelpapier.

- Nun benötigte meine Mutter (Berta Tuttlies geb. Burba), eure Uroma Salzheringe. Sie wurden gewässert und dann eingelegt. Also machte sich mein Vater (Ferdinand Tuttlies), Euer Urgroßvater auf die Beine, um 10 Salzheringe zu holen. Bis Lindenhöhe waren es keine 10 Min. Fußweg auf einer glatten Straße. Für meinen Vater ein schöner Spaziergang am frühen Vormittag. „Öck kom bol wedder“ sagte mein Vater zu meiner Mutter, nahm seinen Krückstock vom Haken, setzte seine „Schlippkemütze“ auf und marschierte dann los! Doch vom baldigen Nachhausekommen wurde nichts. Ich entsinne mich noch, wie meine Mutter immer unruhiger wurde. Die Stunden vergingen un meine Mutter wurde auf Vater sehr böse. Das Mittagessen war fertig und wieder vom Tisch abgeräumt, die Schweine versorgt, die Kühe gemolken und immer noch kein Gebein von Vater. Ich weiß nicht mehr, wann er wirklich kam. Ich habe in Erinnerung, wie er frohen Mutes ins Haus reinkam und vorsichtig das Päckchen mit den Salzheringen auf den Küchentisch legte. Vater hatte zuvor viel zu erzählen, wen er alles im Krug in Lindenhöhe getroffen hatte, alles alte Bekannte und alle geben eine Korn nach dem anderen aus. Ein Korn kostete damals 10 Pf. und er, der Nante Tuttlies, musste tüchtig mithalten – und deshalb ist es auch etwas später geworden.
- Meine schweigsame Mutter hatte inzwischen das Päckchen mit den Heringen aufgemacht – darin lag nur noch ein einziger Salzhering! Auch meinem Vater blieb die Spucke weg. „Ei der Dausend, wo sön de andere geblewe? Bestennt söb se miet ut de natte Papier underweges rutgerutscht!“ Und so war es. Sie hatten ja schon einige Stunde im Packpapier gelegen und es aufgeweicht. Vater nahm darauf stillschweigend seine Schlafdecke und ein Sofakissen unter den Arm, ging über den Hof zum Stall, stieg die Leiter hoch und verschwand durch die Luke auf seinen geliebten Schlafplatz im Heu. Ja und dann? Ich war damals 5 Jahre alt und wurde von meiner Mutter mit einer Schüssel losgescheucht, vielleicht noch einige Heringe am Straßenrand zu finden. Ein Hering kostete 10 Pf. und die 10 Stück 1,-- Reichsmarkt und das war Geld. Und was glaubt Ihr? Ich hatte Glück und brachte alle Neune meiner Mutter heim. Sie lagen meistens verstreut im Gras am Straßenrand. Die „Unglücks-Heringe“ wurden gut gewaschen, gut gewässert und dann sauer eingelegt. Euer Uropa hatte bald seinen Rausch ausgeschlafen, Eure Uroma ihren Ärger vergessen, denn die kleine Marjell, die Hills, hatte ja alles wiedergefunden. Es wurde noch viel darüber gelacht.
- Gasthof Fritz Lerdon
Der Gasthof Fritz Lerdon früher Hedwig Kiehl (1930)
[56]1931 im Gasthof 1.v.rechts: Hedwig Lerdon verwitwete Kiehl, geb. Padefke 2.v.links: Fritz Lerdon (im Hintergrund, verspiegelt), rechts daneben ein Bruder von Fritz Lerdon, links Walter Kiehl, gefallen 1944, im Vordergrund die Eltern von Fritz Lerdon [57]
- Anfang April 1926 wurde ich in ein Matrosenkleid gesteckt, die langen Strümpfe hatte Mutter selbst aus Schafswolle gestrickt (kratzten fürchterlich). Meine schwarzen Spangenschuhe wurden gewienert und einen Tornister bekam ich aufgehubbelt! An Mutters Hand ging es in die zweitklassige Schule nach Pillwogallen. Ich war sehr neugierig auf sie. Als ich dann einige Tage artig auf meinem Platz gesessen und mir alles angesehen hatte, fiel mir ein, dass gerade unsere Küken aus den Eiern zu der Zeit rausgekrabbelten, und ich musste dabei sein! Also ließ ich meinen Ranzen in der Bank liegen und ging nach Hause. Doch ich kam nicht weit. Lehrer Wiederhöft holte mich ein, fasste mich am Schlafittchen und meinte: „Ille (so nannte er mich) Du gehörst in die Schule!" Gefiel mir gar nicht. Viel schöner war es Zuhause, bei meinem Ziegenbock!
- Schulweg und Karteikarte
Ehemalige Schülerinnen auf Schulweg Hildegard Tuttlies und Ursel Weinowski 1943. Links ist die Schule erkennbar [58]
Der Weg zur Schule in Pillwogallen 1992 [59]
Personl-Karte Lehrer Wiederhöft [60]
- Das Foto (58) zeigen die Straße von uns nach Lindenhöhe. Hinter dem Gehöft auf der rechten Straßenseite kam gleich der Dorfteich und dann anschließend, ebenfalls an der Straße gelegen, Opas (Gerhard Kiehl) zuhause. Auf der linken Straßenseite des Bildes ist im Hintergrund ein größeres helles Haus zu sehen. Es war unsere Volksschule. Opa ging hier vier Jahre und anschließend zur Oberschule in Insterburg und Gumbinnen. Ich hielt es acht Jahre aus, ging aber dann noch anschließend zur Handelsschule in Insterburg. Auf dem Foto geht Oma mit ihrer Freundin spazieren. Das Foto in der Mitte zeigen die Straße von uns nach Lindenhöhe im Jahr 1982.
- Schule und Schüler in Lindenhöhe
Schule in Pillwogallen um 1930 [61]
Schüler der Schule in Lindenhöhe 1931, ganz rechts ist vom Lehrer Wiederhöft der Kopf auf Bild nicht mehr zu sehen, davor 2.v.rechtsstehend: Hildegard Tuttlies, daneben sitzend Ursel Weinowski [62]
- Anbei noch einmal unsere liebe alte Schule. Rechts und links je ein Klassenraum, vor dem Haus war ein Spielplatz, hier haben wir in den Pausen Völkerball gespielt oder aber auch Singspiele waren damals an der Tagesordnung, natürlich ohne die „frechen Jungen“. Durch die Haustür kam man in einen kleinen Flur, dort stand ein hohes Schuhregal, worin wir im Winter unsere „Holzschlorren“ hineinstellten, denn fast alle Kinder trugen sie der Kälte wegen mit selbst gestrickten dicken Strümpfen aus Schafswolle. Ein jeder hatte aber warme Hausschuhe für die Schulstube im Ranzen. Auf dem Schulweg kamen wir an der „Haus-Schmiede" vorbei. Sie war tipp topp und er ein guter Schmied. Er hatte schon die dritte Frau am Haken und 12 Kinder und ein sehr baufälliges Wohnhaus, in das es reinregnete. War es des Nachts, wenn sie schon im Bett lagen, sagte sie zu ihm: „Papake, spann dem Scherm op! On et wer wi im Himmel!" In der Schule saßen hinter mir zwei Lautze von der Sorte. Ich hatte lange Zöpfe und die steckten sie mir ins Tintenfass, das hinter mir stand. Und ich hatte ein weißes besticktes Nesselkleid an. Worüber sich Mutter wieder sehr freute! Auch Martha gehörte zur Familie. Sie war eine drugglige Merjell und plinste oft, wenn sie in der Schule nicht weiterwusste.

- Viele Jahre lebten wir in guter Nachbarschaft mit Hermann Weinowski. Er war der Opa von unserem „Heinz Weinowski", der 2001 mit seiner Ursel zu unserer Heimatgruppe kam, und wir wussten beide nicht, wer wir waren! Die Überraschung war groß!
- Die Jahre vergingen und ich durfte schon mal auf den Schwoof gehen. Am schönsten waren die Manöverbälle bei meinen Schwiegereltern im Garten, auch dort war eine Tanzfläche aus Holz vorhanden. Mein Vater hatte meiner Schwester und mir vor dem Gehen zur Aufgabe gemacht, jede noch zwei Kühe zu melken. Meine „Muschekühe" waren artig, ich erzählte mich oft mit ihnen und streichelte sie auch. Aber bei meiner Schwester war es anders. Sie bedeckelte sie oft mit dem Melkschemel — und dann tanzten sie im Ross-garten Polka, zur Soldatenkapelle, die wir schon spielen hörten!
- Und wieder verging die Zeit – und ich hatte meinen Gerhard geangelt, oder er mich? Wir wollen meinen 18. Geburtstag gebührend feiern. Nicht daheim, sondern in Insterburg im Kaffee Alt-Wien! Mein Mann war damals in Insterburg als Berufssoldat stationiert. Ich hatte meine Bleibe bei meinem ältesten Bruder und seiner Familie in der Albrechtstraße 15, dem großen Eckhaus, das heute noch steht. Ich ging in Insterburg zur Handelsschule.
- Alles war vorbereitet und wir saßen mit unseren geladenen Gästen im Kaffee Alt-Wien. Die Musik spielte die schönsten Weisen von „Waldeslust" und „Es war einmal ein treuer Husar...". Der Wein mundete hervorragend und wir waren sehr lustig und vergnügt! Bis ich beim Tanzen plötzlich auf meinem Rücken einen leichten „Schurrr..." vernahm. Ob mich der Gerhard zu sehr an sich gedrückt hatte 9 Ich wollte es wissen und ging zur Garderobenfrau. „Freileinchen — Sie sind aufgeplatzt...!" rief sie. Der ganze Rücken meines schwarzen Taftkleides vom Ausschnitt bis zum Gürtel war bloß...! Und nun stand das aufgeplatzte „Freileinchen" da — was war zu machen? Es war ein Kleid aus Mutters Beständen, das uralt war und für mich umgearbeitet worden war. Die Musik spielte, und ich feierte meinen 18. Geburtstag. Heute wäre ein bloßer Rücken (und noch etwas Nacktes) in Mode gewesen; aber damals? Aber Dank Mutters Fürsorge hatte ich meine lange selbstgestrickte Jacke aus Schafswolle unter dem Mantel an. Sie zog ich über, ging zurück zum Tisch und tanzte und schwitzte mit allen Gästen und meinem Gerhard als „aufgeplatzte Braut"... Das Taftkleid war lange Jahre unbenutzt, es hing gut aufgehoben auf der Lucht in dem großen Schrank, hinter Vaters „Schößchenrock". Taft verschleißt nach Jahren, und das war der Fall.
Kornaust



- Nun ist es über 75 Jahren her, dass wir aus unserer geliebten Heimat vertrieben wurden. Fast nichts konnten wir mitnehmen, aber wir sind voll mit unserem Ostpreußen verbunden und verstehen die alten Ausdrücke, mit denen wir aufgewachsen sind. Wer weiß, was ein „Pomuchelskoopp" ist? (ein dicker, großer Fisch — oder auch ein Schimpfwort „Du Dammliger....!") oder was auch ein „Kalabräser" ist?
- Ich konnte nicht stillsitzen und war immer neugierig. Wenn unsere lieben Nachbarn Onkel Hermann & Tante Auguste Weinowski zu uns in die „Uhleflucht" zum „kadreiern" (erzählen) kamen, war es für mich ein Ereignis! Vater saß dann mit Onkel Hermann auf der Bank vor der Haustüre. „Mien Mutterke" aber mit Tante Auguste im Garten; und ich sauste von einem zum anderen, um viel mitzubekommen! Die lieben Nachbarn waren die Großeltern von unserem Heinz Weinowski, der 2001 mit seiner Ursula zu uns in die „Heimatgruppe Insterburg / Sensburg" kam. Bis dahin wussten wir aber noch nichts voneinander.
- Die schönsten Zeiten waren für mich im Sommer die „Kornaust" und im Winter das „Federreißen" am warmen Kachelofen. Herrlich war es, wenn es draußen schneite oder gar „stiemte"! Wir saßen ja im Geborgenen. Da durften wir Kinder keine „Flunsch" ziehen, wenn uns die Arbeit nicht passte! Wurden wir noch „oppstornosch", gab es von Vater einen kleinen „Mutzkopp", ab und zu „plinsten" wir uns noch aus und wir waren dann nicht mehr „gluppsch", vielleicht noch ein wenig „dreibastig"... (frech)!
- Mutter hat immer gut für Essen und Trinken gesorgt! Von „Klunkermus" mit Farin gesüßt, „Keilchen", „Pierag", selbstgemachte „Glumse" mit selbst gekochter Kirschkreide im großen Waschkessel in der Waschküche unter ständigem Rühren mit Zucker einige Stunden gekocht. „Brennsuppe", „Wrukensuppe", „Kruschkemus", „Kissehl", „Königsberger Fleck" mit 6 Gewürzen, gebackene Stinte — und meine „Spirgel", die ich heute noch gerne esse! Einige Leute daheim waren „Gniefke" (Geizhälse). Sie saßen auf ihren „Dittchen". Selten, daß sie einen „Kornus" geschweige einen „Pillkaller" ausgaben; und zum „Barbutz" gingen sie auch nicht. Dann kam ein „Bowke", er musste aber schon älter sein aus der Nachbarschaft und schnitt ihnen die Mähne mit der Schere. Zuhause wurden von Männern viel „Klumpen" und von Frauen „Schlorren" getragen. Prima waren sie zum „Schorren" auf dem Eis. Es ging aber auch ohne sie — auf selbstgestrickten dicken Socken aus Schafswolle! Im Hause schlüpfte man in warme „Wutschen", die oft per Hand hergestellt waren. Erläuterungen dieser ostpreußischen Ausdrücke unter : Begriffe: "Der ostpreußische Dialekt"
- Gingen wir aber zum „Schwoofen", wurden die Sonntagsschuhe angezogen. Während des „Schwoofens" bekam man auch ab und zu mal einen „Bärenfang" spendiert und zum "Verzählchen" eingeladen. Die Männer tranken gerne „e Tulpche Bier", aber nicht zu viel, dass man sich nicht de „Tuntel" begoss! Auch wenn derjenige seine Spendierhosen anhatte, und noch gerne einen ausgegeben hätte! Aber auf dem Nachhauseweg hätte man sich leicht „verbiestern" können! Schlimm war es, wenn ich als kleine „Marjell" einer „Ziegahnsche" oder einem „Pracher" begegnete. Dann nahm das Betteln kein Ende. Hatte ich für sie etwas inne „Fupp", einen „Knasterbombom" oder einen Dittchen, war ich sie los! Mein Vater war wütend, wenn der „Koppschäller" (Pferdehändler) immer wieder zu uns kam. Dieser hatte es auf unsere „Rieke" abgesehen. Sie kam aus Neu Lappönen und war eine Trakehner Stute, Vater hat dann immer überlegt, wie er den Kerl auf Nimmerwiedersehen loswürde!
- Aus der Gegend Friedrichsdorf und Große Friedrichsdorf kamen häufig auch die Zwiebelfahrer. Sie kamen zu uns mit Pferd und Wagen und riefe: „Zippeln, Zippeln“. Sie tauschten Zwiebeln gegen Roggen. Gemessen wurde nach Scheffel, ein hölzernes Hohlmaß ca. 40 Inhalt.
- Zu unserer Nachbarschaft gehörte auch die Familie Baltruweit. Sie saßen auch auf einem Bauernhof, Vater, Mutter, Opa, Oma und vier „Marjellens". Opa und Oma waren auf dem Altenteil. Diese bewohnten die kleinste Stube, nur dass sie zur Nacht eine Bleibe hatten. Am Tage waren sie immer noch mit leichter Arbeit in Haus und Hof beschäftigt. Nun hatte Opa Baltruweit in der Nacht oft Nacken- und Kopfschmerzen. Also stand er wieder mal im Halbdunkel auf, tastete sich an sein Regal mit dem verschiedenen Einreibemittel in Fläschchen. Das Mittel wirkte Wunder, dachte er, er konnte schlafen und kam am anderen Morgen munter in die Küche. Doch „o Schreck" — Opa war blau im Gesicht, an den Händen, am Nacken! Ja, das war das Ende vom Lied — Opa hatte im Dämmerlicht de Tintenflasche erwischt; die in Reserve im Regal stand! Vater gab aber Opa den guten Rat: Bloß nicht mit Tinte de Kopke önriewe, dat helpt nich...!
- Eine der vier Marjellens ist meine liebe Gerda. Mit ihr bin ich zusammen zur Schule gegangen, sie ist genau so alt wie ich. Sie wohnt in Bielefeld. Wir stehen bis zum heutigen Tage noch immer in Verbindung und sind dick befreundet. Wir telefonieren oft miteinander und tauschen unsere Erinnerungen aus — meistens auf platt! Auch unsere liebe Heimatgruppe ist immer im Gespräch... Ja, das war mein Zuhause, mein warmes Nest!
Kindheit

- Es war für uns Kinder zu Winterzeit eine Freude, auf blanken Eisflächen auf Schlorren zu rutschen – „schorren“ sagten wir. Noch besser aber ging es auf den dicken Strümpfen, also ohne Schlorren. Und das schönste war, meine Mutter hat nie geschimpft, wenn ich nass nach Hause kam „De Kinderdes motte sich uttobe“ sagte sie.
- Ich wollte gerne unserem Hofhund beibringen, mich auf meinem kleinen Rodelschlitten zu ziehen. Leider ist es mir nie gelungen. Gewiss lag es daran, dass er nur mit einer Schnur am Schlitten festgebunden war. Opa hatte darin mit seinem großen Hund mehr Glück, der Hund gehorchte ihm, er war ja mit einem richtigen Geschirr vor den Schlitten gespannt. Leider, leider hat Opa damals eure Oma noch gar nicht angeguckt, vielleicht hätte er mich dann einmal mitgenommen bei seine Hundeschlittenfahrten.
- Schön waren die Rodelschlittenfahrten über weite Strecken zur Schulzeit. Die Väter der Bauernkinder kamen dann mit Pferden auf einem stabilen Schlitten an der Schule vorgefahren und daran waren unsere Rodelschlitten hintereinander angehängt. Meist fuhren auch mehrere Gespanne mit Schellengeläut die Kinderschlitten im Anhang und viel Frohsinn zum nahen Wald und wie oft sind wir dann da runtergepurzelt. Wenn aber in meinem Zuhause im Winter mit dem großen Schlitten und zwei Pferden spazieren gefahren wurde, kam in die große Pelzdecke, die den Schlitten ausfüllte, ein warmer Ziegelstein. Er war im Bratofen aufgeheizt und blieb sehr lange warm. Ich durfte zwischen meinen Eltern sitzen und war so warm verpackt, dass nur die Augen rausschauten. Meistens ging es auch in den Wald. Vater nahm dort die Schlittenglocken von den Pferden ab. Er meint: „Wir wollen die Stille nicht stören“. Es wurde auch nicht viel gesprochen.
- Ja – unsere Winter in Ostpreußen waren einmalig! Viel Schnee mit viel Sonne und klarem blauen Himmel. Dazu strenger Frost um die 20 Grad minus. Der Winter war sehr lange, mitunter fuhren wir zu Ostern noch mit dem Schlitten. Vor Weihnachten, in der Adventszeit, gab es dicken Raureif. Das war für mich immer eine Märchenwelt. Nicht zu vergessen waren die meterhohen Schneewehen bei „Stümwetter“ – trockener Pulverschnee vom Sturm zusammengeweht. Bei schlimmem Sturm mit eisiger Kälte wurden Straßen und Höfe, Zäune und Gebüsch wurden zu hohen Schneeflächen. Es fuhr kein Schlitten, niemand wagte sich aus dem Haus. Die Schule fiel aus und wir bliebe allem im warmen Zuhause. Wenn der „Spuk“ vorbei war, wurde Schnee geschippt. Ich habe mir in den hohen Schneewehren Höhlen gebaut. Für warme Winterbekleidung hat mein Vater für uns gesorgt. Er war auch Schneider und hat für Mutter und uns Kinder Mäntel und Jacken mit Pelz abgefüttert genäht. Wir haben nie gefroren, obwohl lange Hosen damals von Mädchen noch nicht getragen wurden. Dafür hat dann aber meine Mutter Strümpfe und Unterwäsche auf Schafwolle gestrickt. Die kratzten fürchterlich.
- Der Monat Dezember war mit viel Arbeit ausgefüllt. Zu Anfang wurden zwei dicke Schweine geschlachtet. Daraus wurden auch herrliche Würste gemacht, Dauerwurst, Leberwurst, Blutwurst und meine Grützwurst. Viel Fleisch wurde in Gläsern eingeweckt, Schinken und die Speckseiten kamen in Holzfässern zum Pökeln in Salzlauge. Nach vier Wochen kamen sie in die Räucherkammer, die am Schornstein angebaut war. Meine Schwester musste die Kochwürste kochen. Dabei durfte sie nach altem Brauch nicht sprechen – sonst platzen sie. Alle Nachbaren erhielten zur Probe eine Schüssel volle „ganzer“ Kochwürste. Nach dem Schweineschlachtfest mussten die Gänse daran glauben. So 10 oder 12 Stück waren es in jedem Jahr. Es begann in aller Frühe das Gänserupfen. Dazu wurde eine große ovale Zinkwanne in der Küchenmitte gesteilt und wir saßen alle auf Stühlen drum herum. Jeder hatte eine Ganz auf dem Schoß und musste die fein und sauber abrupfen, getrennt nach Federn mit Posten und Daunen. Wir alle hatten zu Schluss – es dauerte mehrere Stunden bis wir fertig waren überall Federn sitzen. Mein Vater hatte sie im Bart, Mutter in den Haaren, Onkel Erich steckte sich meiste die großen Flügelfedern hinter beide Ohren, Tante Friedel hatte sie auch in ihrem krausen Haar und mir krochen die Daunen stets in die Nase und beim Niesen wirbelten sie in der Wanne hoch.
- Es wurde viel gelacht, denn im Grunde lachte uns schon der leckere Gänsebraten entgegen. Nach dem Schlachtfest wurden Plätzchen gebacken. Der Teig dafür war schon einige Woche fertig. Er stand in einer großen gut zugedeckten Schüssel in der großen Stube im Kalten, denn diese Stube wurde im Winter – bis auch Weihnachten und Sylvester - nicht benutzt. Das Backen der Pfefferkuchen ging schnell vor sich. Vier Bleche auf einmal konnten in den großen Backofen, der mit Holz geheizt wurde, geschoben werden. Da musste schnell ausgerollt und schnell ausgestochen werden. Und wieder war die ganze Familie der Tuttliesen dabei, selbst Onkel Erich ließ sich erweichen, er und euer Uropa verkrümelten sich aber bald.
- Annelie Kiehl und Hedwig Lerdon, verw. Kiehl
Tante Anneliese Kiehl mit Jagd- und Hofhund auf dem Hof des Gasthauses[68]
Oma Hedwig Lerdon mit erlegtem Hasen im kleinen Saal ihres Gasthauses in Lindenhöhe [69]
- Die Vorfreude auf Weihnachten wurde noch durch unser Weihnachtsfest in der Schule verschönt. Es wurden Theaterstücke, Lieder und Gedichte eingeübt und die Kostüme wurden auch selber genäht. Das war ein Spaß. Sogar eine Bühne wurde gebaut. Es klappte alles prima. Zum Schluss kam ein großer Weihnachtsbaum ins Schulzimmer; dann wurden die großen Schiebetüren, die die beiden Klassenräume verbanden, aufgemacht – und die Lindehöher Schule hatten den schönsten Theater-Raum.
- Unseren eigenen Weihnachtsbaum hat mein Vater stets besorgt, woher er ihn hatte, wurde nie verraten. „Vom Weihnachtsmann“ sagte er lachend. Das Weihnachtsfest selbst war eine riesige Freude in meinem Elternhaus. Es gab nicht viele Geschenke. Meine heißgeliebte Puppe begab sich immer in der Adventszeit auf eine Winterreise, sie kam aber dann stets am Heiligen Abend mit neuen Kleidern wieder zurück. Aber da stand der prächtige Tannenbau, der uns allein schon in festliche Stimmung versetzte. Dann begann Eure Uroma „Stille Nacht, heilige Nacht“ leise zu singen und wir alle stimmten fröhlich mit ein. Wir saßen am warmen Kachelofen, draußen war tiefer Winter. Es duftete nach Weihnachten in der großen Stube und in der Küche brutzelte der Gänsebraten. Euer Uropa saß in seinem Stuhl, hatte die Hände gefaltet und sagte nur „Kinder, sön dat wedder scheene Wiehnachte“.
- Es war Herbstzeit und wieder einmal hatte Euer Uropa Fritz Hasen geschossen. Eure Uroma Hedwig Kiehl - Lerdon hat auf einem Foto einen dicken erlegten Hasen auf dem Arm. Sie steht vor der Verandatür auf der Hofseite. Uropa Fritz war zuhause Jagdpächter und durfte im Herbst und im Winter Wild schießen. Es wurden zur Jagd Freunde und Verwandte eingeladen. Eine große Gesellschaft machte sich auf die Beine. Auf dem Foto rechts ist Tante Anneliese (Kiehl) auf dem Hof zu sehen mit Uropas Jagdhund „Arac“. Dahinter steht der Hofhund „Lord“. Zu jeder Jagd gehören auch Treiber. Es waren junge Leute aus dem Dorf. Sie haben zusammen mit den Hunden die Hasen aufgestöbert und sie den Jägern zugetrieben, denn die Hasen hatten sich in Hecken und Büschen verkrochen. Das geschah mit großem Lärm. Der Ausklang solcher Jagdtage war ein großes Essen bei Eurem Großvater in der Gastwirtschaft Eure Uroma Hedwig hatte mit den Frauen aus der Nachbarschaft alles bestens vorbereitet. Es ging lustig zu. Es wurde gut gegessen und dazu ordentlich getrunken, viel erzählt, viel gelacht und zuletzt ordentlich gesungen. Uropa Fritz begleitete auf dem Klavier. Die geschossenen Hasen hatte inzwischen der Kutscher mit dem Pferdefuhrwerk nach Hause geholt und auf dem Dachboden zum Abhängen aufgereiht.

- In der Gaststätte wurde im Allgemeinen kein Essen angeboten, da die Gäste in der Regel vor oder nach dem Besuch schon zu Hause aßen. Es gab aber Kleinigkeiten wie Soleier, Halben Hering oder eingelegten Zwiebeln oder Sure Gurken und für die "Damen" Schokolade oder Bomche. Wurde bei großen Festen dennoch ein Essen eingeplant, so gab Hilfe aus dem Dorf und in einem Nebengebäude - das auch als Waschküche diente - wurde der lange Schamott-Herd zum Kochen, Braten und Warmhalten angeworfen und der große Geschirrschrank aufgeschlossen. Das Besteck stammte zum Teil noch aus einem russischen Offizierskasino aus dem 1. Weltkrieg. In der Regel fanden aber alle Familienfeste zu Hause statt.
- In Opas Zuhause (Gasthof Lerdon) fanden im Sommer an Wochenenden die Tanzvergnügungen im Freien statt – falls es nicht regnete. Es war im Garten eine Tanzfläche mit Holzdielen vorhanden. Die Dielen wurden vorher extra gebohnert. An der Theke bediente Onkel Walter zusammen mit Nachbarinnen aus dem Dorf. Flotte Weisen spielten zwei Dorfmuskanten zusammen mit Uropa Fritz auf. Uroma Hedwig überwachte die Kasse. Auch unsere Sommerschulfeste wurden hier gefeiert mit Volkstänzen, Liedern und Gedichten. „Sommer o Sommer du fröhliche Zeit“ sangen wir hier bei unserem Umzug von der Schule durch das Dorf zu Opas Garten. Alle Kinder waren festlich herausgeputzt. Selbst der „Rüpel“ Otto Schützler, der mal meine Zöpfe ins Tintenfass gesteckt hatte, sah richtig schick aus, sein Haarschopf hatte einen geraden Scheitel. Wir Mädchen trugen zum Umzug halbrund Holzbügel, die mit Blumen umflochten waren, in den Händen. Unsere beiden Lehrer gingen voran – und so hielten wir den Einzug in den Festgarten, wo schon alle auf uns warteten. Jedesmal waren wir froh, wenn Petrus für uns die Sonne scheinen ließ.
- In der Gastwirtschaft geschah allerlei. Viele Dörfler trafen sich hier. Alle kamen sie mit Pferd und Wagen, im Winter mit Schlitten. War das Wetter kalt, wurden die Pferde gut eingedeckt.- oder sie kamen in die „Einfahrt“ – ein großer Stall, der für die Pferde der Gäste gebaut worden war. Alle Gäste – zogen, bevor sie die Gaststube betraten, ihre Holzklumpen aus. So ging einmal ein Bauer aus Bessen nach seinen Pferden sehen und war überrascht – seine Holzklumpen waren angenagelt – er hatte seine Schulden nicht gezahlt.

- Oft kam auch der Gutsbesitzer und sehr erfolgreiche Rinder- und Pferdezüchter Johann Scharffetter im Sommer zu einem Rotwein oder im Winter zu einem Grog mit seinem Spazierwagen in die Gaststätte. Im Wagen saßen er und sein großer treuer Hund. Scharfetter steuerte dann alleine in „seine“ Ecke in der Gaststube, zu Füßen sein Hund und auf dem Tisch div. Flaschen - im Sommer Rotwein oder Rum im Winter. So saß er sehr lange und schlief ein und er und sein Hund fingen an zu schnarchen. Uropa Fritz (Lerdon) hat dann die Petroleumlampe auf Sparflamme gestellt und ist ins Bett gegangen. In der Nacht ist Herr Scharfetter aufgewacht, fand in der Regel mit Hilfe des Hundes zum Spazierwagen und schlief, so wurde beobachtet, im Wagen wieder ein. Sein treues Pferd fand den Weg nach Hause alleine – zu jener Zeit fuhren ganz selten Autos nachts auf den Straßen.
- Als Uropa Fritz – auch nachts mit seinem neuen Mercedes die Straßen unsicher machte – war das eine Sensation. Zeugen bekundeten, dass er das "nur" tue, um Gäste nach Hause zu fahren. Besonders zwei unerschrocken nach Ostpreußen versetzte Lehrerinnen aus Köln benutzte zusammen diesen Service - so dass es schon zu besorgte Nachfragen des Schulrates kam, die aber grundlos waren. Der Besuch von Gasthäusern von alleinstehenden Lehrerinnen war den Dorfbewohner suspekt. Die beiden verkündeten aber „ … der rheinische Frohsinn ist hier noch nicht angekommen" und wurden langsam in der Gaststätte akzeptiert.
- Schwiegermutter Hedwig Lerdon führte nach 1941 den Laden an 2 Tagen in der Woche fort, sofern es die Versorgungslage zu ließ, bis zur Flucht im November 1944 allein weiter. Die Ladenöffnung war auch für die Einlösung der Lebensmittelkarten und Bezugsscheine wie z. B. von Petroleum von großer Wichtigkeit. Fritz Lerdon war einberufen war und nur während des Soldatenurlaubs zu Hause. Die Gaststätte wurden nur für amtlichen Zusammenkünfte und für "Privat-Kunden" geöffnet. Nach und nach blieben aber alle wehrpflichtigen Männer weg, da sie eingezogen wurden. Später wurde Köln, nach einer Zwischenstation in Mirow, für die Familien Lerdon das Ziel der Flucht aus Ostpreußen.
- Im Jahre 1934 wurde Lindenhöhe mit elektrischem Strom versorgt. Uropa war einer der ersten im Ort, denn ein Anschluss war damals sehr, sehr teuer und nicht jeder konnte ihn sich leisten. Jedenfalls hat es geklappt und Euer Uropa hat aus diesem Grund ein Lichtfest veranstaltet. Dabei wurden die größten seiner Petroleumlampen mit großem Gefolge und Musik im Dorfteich versenkt. Umwelt war damals ein unbekanntes Fremdwort. Ich habe das Petroleumlicht gerne gemocht – aber wehe, wenn die Petroleumkanne leer war. Dann hatten wir kein Licht, dann dauerte unsere „Uhlenflucht“ bis zum Schlafengehen. Im Sommer brauchten wir kaum Licht, dafür im Winter umso mehr. Die „Uhlenflucht“ fand bei uns im Sommer auf der Hausbank vor der Tür draußen statt, im Winter war die Bank vor dem warmen Kachelofen der Versammlungsplatz. Dann haben meine Eltern aus ihrer Kinderzeit und ihrem Zuhause erzählt. So hatte meine Mutter schon mit 6 Jahren Strümpfe stricken müssen. Mein Vater hatte vor der Schule schon Vieh und Gänse hüten müssen. Als Schuljunge erhielt er eine besondere Genehmigung, die ihn als Hütejunge zwei Tage in der Woche von der Schule freistellte.
- In meinem Zuhause sollten erst 1939 elektrischer Strom gelegt werden. Zunächst gab es auch nur vier Lampen und eine Steckdose. Im selben Jahr brach auch der 2. Weltkrieg aus und wir haben unsere Petroleumlampen behalten. Euer Opa hatte als Junge eine Vorliebe für den Heuboden. An langweiligen Sonntag-Nachmittagen klemmte er sich ein Karl May Buch unter den Arm – es gab vier verschiedene Bände – und stieg die Leiter hinauf und entschwand durch die Luke im Heu. Vor hier konnte er auch alles prima überblicken, wurde er gerufen, hat er sich nie gemeldet, denn das Versteck war sein Geheimnis – und er hat es auch keinem verraten. Als ältester seiner vier Geschwister wurde er regelmäßig zu deren Aufsicht eingeteilt. Der Autor Karl May veröffentlichte bis 1914 bereits 1,6 Millionen Bände. Seine Schriftstellerkollegin Hedwig Courths-Mahler kam bis 1914 mit ihren Romanen der "Schicksalsergebenheiten" und dem Vorbild des traditionellen Verhalten von Frauen aber bereits auf 14 Millionen verkaufte Bände. Ich hatte mich extra in der Buchhandlung in Aulowönen erkundigt, ob Courths-Mahler "schon war für mich wäre". Die genannten Auflagezahlen habe ich bis heute behalten.
- Unser Leben auf dem Lande war aber nicht langweilig – eben bis auf die Nachmittags-Sonntage. Ich bin dann meistens viel mit dem Rad gefahren. Mit 12 Jahren erhielt ich mein erstes Fahrrad, mit 14 Jahren zur Konfirmation die erste Armbanduhr und mein erstes Buch - es war ein Gesangsbuch.
- Ein Radio hatten wir dann später auch schon. Leider wurde es ganz selten angemacht. Weil wir noch keinen Strom hatten, war das Radio an Anoden und Akkumulatoren angeschlossen, und diese Batterien wurden schnell leer und mussten dann zum Aufladen weggebracht werden, was immer einige Tage dauerte, bis man sie wieder abholen konnte. Nun hörte aber meine Mutter und natürlich auch die Kinder sehr gerne Radio, aber mein Vater schimpfte dann – es wäre zu teuer. Er ist dann aber zeitig zu Bett gegangen und wenn er anfing zu schnarchen, war es so weit, dass wir das Radio wieder anstellen konnten. Gehört haben wir den Reichssender Königsberg. Im Winter waren die Abende oft mit Radiosendungen ausgefüllt. Wenn wir keine Arbeit vorhatten, Stricken, Stopfen, Nähen und ähnliches, saßen wir am warmen Kachelofen, draußen war dichter Schnee und der Mond schaute zum Fenster rein, dazu viele Sterne am wolkenlosen Himmel und wir hörten eine Stunde Radio. Meine alte Katze saß auf meinem Schoß, sie wurde dann aber vor dem Schlafengehen von mir in den Stall gebracht.

- Eine Sensation waren zuhause die Zigeuner. Im Winter "wohnten" zwei "Sippen" auf auf einem aufgelassenen Gutshof in Lindenhöhe. Im Sommer fuhren sie in ihren Planwagen über Land. Woher sie kamen und wohin sie wollten wusste niemand. Ein Planwagen war ein einfacher Wagen - überspannt mit starken Weidenruten und darüber ein Tuch als Plane gezogen, zum Schutz gegen Wind, Sonne aber auch Regen. An der Außenwand des Wagens baumelten verbeulte Kochtöpfe, Bratpfannen oder Eimer, in dem Wagen unter der Plane saßen die Frauen mit den Kindern auf Stroh. Der Zigeunervater saß vorne im Wagen und lenkte ein müdes Pferd. Oft aber schwärmten alle aus, um mitzunehmen was nicht niet-oder nagelfest war. Weil das Land zuhause flach war, sahen wir sie schon von weiten auf der Straße ankommen, immer mehrere Fuhrwerke auf einmal. Dann kam unser Vater in Haus gestürmt und rief: „Kinder, de Ziegäner kome“. Falls Wäsche auf der Leine hing, wurde sie schnell abgenommen, die Hühner, Gänse und Schweine in den Stall gescheucht, das Hoftor und alle Türen und Fenster fest verschlossen und der Hofhund Lux wurde losgemacht. Nichts war vor ihnen sicher. Mein Vater stand irgendwo versteckt auf dem Hof und passte auf, wenn sie zum Betteln anrückten. Mir war eine solche Sippe immer interessant, gab doch viele, viele Kinder zu bestaunen, die neben den Wagen liefen und so vor den Hof erst zu singen und dann zu betteln anfingen. Die Kinder führten ein freies Leben – ohne Schule! Meine Eltern wollten - nachdem ich sie gefragt hatte - aber keine Zigeuner werden.
Hildegard Kiehl berichtet weiter:
- Für mich war es immer eine Freude, wenn ich während meiner Schulzeit nach Insterburg zu meinem Bruder Max mit meiner Schwester fahren durfte. Er hatte ein Geschäft mit vielen, vielen Bonbons.•
- Kolonialwaren Laden Max Tuttlies
1930 Vor Ihrem Kolonialwaren: von links: Max mit Ehefrau Gertrud, Hildegard & Friedel Tuttlies, Insterburg. [73]
1931 Einblick in den Kolonialladen. von links: Gertrud und Max Tuttlies, Erich Tuttlies und Friedel Tuttlies [74]
- Eine wichtige Einnahmequelle für seinen Kolonialwarenladen zuhause, waren die wohlhabenden Schüler der nahe liegenden Schulen die regelmäßig versuchten, ganz viel Bomche für ganz wenig Dittchen zu erstehen. Als tüchtiger Kaufmann hatte mein Bruder Max (Tuttlies) zum Wechseln immer viel Kleingeld in der Ladenkasse. Angeblich versuchten einige Eltern, durch ein Ladenverbot die Kauflust Ihrer Sprösslinge in den Griff zu bekommen.
Der Zweite Weltkrieg
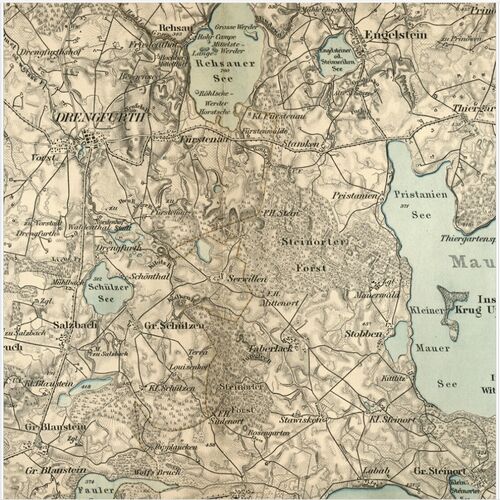
- Am 1. September 1939 war der Krieg ausgebrochen — aber wir fühlten uns in unserem Ostpreußen in Sicherheit. Wir waren ja weit weg vom Schuss, vom großen Deutschen Reich und hatten reichlich zu essen und zu trinken, und wir waren ja die Kornkammer Deutschlands! „Denn heute gehört uns Deutschland", sang die Jugend vor Begeisterung! Ich war 19 Jahre alt und hatte mir nach der Handelsschule durch die Landhilfe, eine Stelle im Büro im herrlichen Masuren in Pristanien / Paßdorf bei Angerburg gesucht. Es war die große Baumschule „ Bruno Wenk " mit 12 Angestellten, vom Obergärtner bis zu den Lehrlingen; dazu war mein Chef „Bürgermeister" und die Postagentur gehörte auch da hinein. Im Büro waren wir zwei Angestellte, also gab es reichlich zu tun. Aber trotzdem war ich viel am Mauersee, der ganz in unserer Nähe lag. Die Bunkern des Hauptquartiers des Oberkommandos der Wehrmacht lagen beim Dorf Mauerwald am Mauersee, das spätere Führerhauptquartier, die „Wolfsschanze" wurde bei Rastenburg gebaut. Wir hatten ein weibliches Arbeitsdienstlager mit über 100 Maiden in unserem Bezirk (Kreis Rastenburg). Sie waren im „Reich" beheimatet und bekamen viel Post, die sie sich selbst abholten.
Der folgende Text wurde eingefügt:
Das Pflichtjahr wurde 1938 von den Nationalsozialisten eingeführt. Es galt für alle Frauen unter 25 Jahren – sogenannte Pflichtjahrmädel/-mädchen – und verpflichtete sie zu einem Jahr Arbeit in der Land- und Hauswirtschaft. Es stand in Konkurrenz zum etablierten Landjahr sowie ab 1939 durch die Einführung des Reichsjugenddienstpflichtgesetzes zum Dienst im Rahmen des Reichsarbeitsdienstes (RAD). Dies betraf vor allem jene Jugendlichen, die bis dahin keiner Parteijugendorganisation angehörten und zudem auch keine Berufsausbildung absolvierten. Die Zwangsverpflichtung im RAD erfolgte dabei nach rein willkürlichen Richtlinien, ohne Rücksicht auf Interessen, Fähigkeiten oder Affinitäten jeglicher Art. Weder der Dienstort noch die Art der Tätigkeit standen dabei zur Auswahl.”
Neben dem männlichen Arbeitsdienst war mit dem Reichsarbeitsdienstgesetz auch der weibliche Arbeitsdienst (RADwJ) für junge Mädchen (Arbeitsmaiden) im Alter von 18 bis 21 Jahren eingeführt worden. Ab dem Jahr 1938 entstanden überall im damaligen Deutschen Reich 327 Lager des weiblichen Arbeitsdienstes, von denen 108 als Bauernlager, 116 als Siedler- und 108 als NSV-Lager (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) anzusprechen waren. Damit zeigte sich bereits die Einsatzart der weiblichen Arbeitsdienstangehörigen. Sie wurden entsprechend auf Bauerhöfen als Hilfskräfte (Mägde) eingesetzt oder in landwirtschaftlichen Siedlungen als Kindermädchen, Säuglingsschwestern, Lehrerinnen oder als eine Art von Sanitätspersonal.


Hildegard Kiehl fährt fort:
- Auch ich bekam viel Post von Opa! (d.h. ihrem späteren Ehemann. red.) Zuerst aus Insterburg, später kamen dann Feldpostbriefe von der Front. Auch besucht hat er mich oft in Masuren. Die Zeit lief dahin. Ich war dort von 1939 bis 1942, drei Jahre — und dann kam der grausame Krieg immer näher an unsere Heimat. Mein Bruder Erich (Tuttlies) , der auf dem Hof bei meinen Eltern lebte, wurde zur Front eingezogen. Als Sanitäter arbeitete er meistens in Lazaretten. Für ihn erhielten Uropa und -Oma einen Weißrussen, Michael, als Arbeitskraft. Er war ein anständiger und fleißiger junger Mann, er war gerne bei uns.
- Dann erkrankte mein Vater am Herzen, meine Mutter schaffte es auch nicht mehr, und so ging ich dann nach Hause. Ich wäre auch gerne dortgeblieben. Ich hatte großen Spaß an der vielseitigen interessanten Arbeit. Zwar waren fast alle deutschen Baumschulangestellten zur Wehrmacht eingezogen. Aber an ihrer Stelle kamen 20 polnische Hilfsarbeiter, die kaum deutsch sprachen mit einem deutschen Wachmann, der stets eine Pistole bei sich trug, es war grausam! Doch der Versand der vielen Obstbäume, der Nadelhölzer, der Nutz- und Ziersträucher musste ja weitergehen. Am 15.05.1942 verließ ich das Büro der Baumschule Bruno Wenk in Paßdorf um zu Hause, den kranken Vater Ferdinand Tuttlies zu unterstützen. So war ich dann wieder zuhause. Opa kam ab und zu mal von der Front in Urlaub. Die Rückfahrt zur Front war dann immer am schlimmsten. Im Oktober 1943 haben wir geheiratet. Ich blieb aber in Wilkental wohnen. Die Front rückte immer näher.
- Nachdem die Wehrmacht in Polen besiegt war, rückte Russland weiter vor. Die größten Städte in Ostpreußen wurden schon bombardiert. Im Sommer 1944 musste nach Königsberg auch Insterburg daran glauben. Es war sehr schlimm; denn mein ältester Bruder Max (Tuttlies) wohnte in Insterburg in der Albrechtstraße Nr. 15 mit seiner Familie dort. Es blieben dort alle verschont und Frau und Kinder wurden nach Kroslitz bei Leipzig evakuiert. Allerdings wurde sein Laden zerstört. Meine Schwester Friedel wohnte in Königsberg. Ihr Mann war an der Front und sie wurde mit den Kindern nach Lugau im Erzgebirge evakuiert.
Einschub:
Zur Entstehung des Insterburger Wappen heißt es: Das Wort "Inster" war in der baltisch-preußischen Sprache der Name des Flusses, an dem die Burg errichtet wurde, und wird verwendet, um mit "Flüsse" übersetzt zu werden. Das Wort "Burg" bedeutete auf Deutsch "Festung". Der ganze Name "Insterburg" wurde mit "Festung am Wasser" übersetzt. Der Ortsname Insterburg wird 1340 erstmalig erwähnt: „ad castrum Insterburg“. Die Instierburg wurde nach 1256 an Stelle der Prußenburg Unsatrapis erbaut. Das Herzogtum Preußen wurde vom ehemaligen Hochmeister des Deutschen Ordens Albrecht, der zum (lutherischen) Protestantismus konvertiert war, gegründet. Es war das erste Fürstentum im frühmodernen Europa mit lutherischem Glauben. Der preußische Herzog Albrecht säkularisierte im Zuge der Durchsetzung der Reformation 1525 die Ordensburg Insterburg und machte sie zu einem weltlichen Hauptsitz. In diesem Hauptamt gab es 1544 nur ein einziges Kirchspiel, nämlich Insterburg selbst. Doch dann kam die Kolonisierung in Schwung. Bis 1558 folgte das Kirchdorf Gawaiten und bis 1562 das Kirchdorf Pillupönen. 1590 nannte das Kirchspielverzeichnis 13 Kirchspiele mit rd. 500 Orten. 1541 wurde Insterburg als Stadtflecken anerkannt und Sitz eines Amtshauptmanns und 1583 erfolgte die Erteilung des Stadtprivilegs durch den Regenten Markgraf Georg Friedrich von Hohenzollern-Ansbach.
Das noch von Wildnis geprägte Umland ließ er besiedeln. Zur Zeit der Stadtrechte erstreckten sich Urwälder rund um Insterburg. Sie fanden oft Bären, aber auch Elche und Hirsche. Nur der Besitzer des Landes hatte das Recht zu jagen. Die Leidenschaft für die Jagd in einer so wildreichen Region faszinierte Markgraf Georg Friedrich. Er hielt sich oft in den Jagdrevieren von Insterburg und in der Festung selbst auf. Als Georg Friedrich schließlich am 10. Oktober 1583 die Stadtrechte an Insterburg verlieh, brachte er seine Liebe zur Jagd zum Ausdruck, indem er den Bären und den Jäger in der Darstellung des Stadtwappens verewigte. In der Satzung heißt es: "Wir wollen der Stadt Insterburg ein eigenes Siegel geben, mit dem die notwendigen Dokumente beglaubigt werden sollen..".
Nämlich: ein weißer Schild, unten ein grüner Berg, darauf steht ein Schwarzbär auf allen Pfoten, und auf beiden Seiten im Inneren des Schildes stehen zwei Buchstaben G F - die Initialen von Georg Friedrich. Auf dem Schild befindet sich eine Figur (vermutlich Georg Friedrich selbst), die einen Jäger darstellt, der ein Horn in den Händen hält. Der Hintergrund ist in der entsprechenden natürlichen (grünen) Farbe gemalt. Um den Jäger herum befindet sich in einem Halbkreis eine Inschrift in lateinischer Sprache: "Sigill civitatis Insterburgensis" (Siegel der Stadt Insterburg). (Tschernjachowsk). Georg Friedrich I. (* 5. April 1539 in Berlin; † 25. April 1603 ebenda) war Markgraf von Brandenburg-Ansbach und Brandenburg-Bayreuth (Kulmbach), Herzog von Jägerndorf, Regent von Preußen. Der letzte der fränkischen Linie der Hohenzollern.
- Flagge und Wappen von Insterburg
Flagge von Tscherjachowsk (Insterburg) [78]
Stadtwappen von Insterburg, auf Notgeldschein, ausgegeben von der städtischen Sparkasse Insterburg während der Inflation von 1921, 70 Pfennige[79]
Rückseite von Notgeldschein 70 Pf. [80]
Im September 2019 entschied ein Gericht im Oblast Kaliningrad, dass das Wappen geändert werden müsse, da es keine alphabetischen Zeichen enthalten dürfe. Daraufhin wurde am 13. November 2019 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit Vertretern der Öffentlichkeit, Ethnographen und Heraldikern entscheiden soll, ob das Wappen in seiner ursprünglichen Form ohne Schriftzug bleibt oder ganz neu entworfen werden soll Quelle: 70 Pfennig 1921, Insterburg Detailbeschreibung (notescollector.eu)
Zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs war Insterburg aber eine wichtige Garnisonsstadt der preußischen Armee. Im Osten der Stadt entstand ein großes Kasernenviertel. In Insterburg standen 1914 das Kommando der 2. Division mit zwei Brigadekommandos und mehreren Verbänden der Infanterie, Kavallerie und Feldartillerie (darunter zwei Bataillone des Infanterie-Regiments 45), insgesamt über 2000 Soldaten. 1902 schied die Stadt Insterburg aus dem Landkreis Insterburg aus und bildete einen eigenen Stadtkreis. 1913 wurde ein Bismarckturm errichtet. Nach Beginn des Ersten Weltkriegs war die Stadt infolge der Schlacht bei Gumbinnen vom 24. August bis 11. September von der russischen Armee besetzt und wurde danach Hauptquartier von Paul von Hindenburg.
In der Zeit der Weimarer Republik war Insterburg Sitz des Landratsamtes, eines Amts-, eines Land- und eines Arbeitsgerichtes, eines Finanz- und eines Zollamtes, einer Reichsbank-Nebenstelle sowie einer Industrie- und Handelskammer. Die Wirtschaft hatte sich mit der Ansiedlung von Ziegeleien sowie von Unternehmen zur Herstellung von Zuckerwaren, Essig und Mostrich, Chemikalien und Lederwaren weiter diversifiziert. 1926 wurde nach Fertigstellung des Pregelseitenkanals der Hafen Insterburg eingeweiht. Nachdem die Stadt zur Zeit der Reichswehr ihre Garnison behalten konnte, erfolgte von 1935 bis 1937 der Bau eines großen Flugplatzes und von Kasernen für die Wehrmacht. 1939 wurde mit der Restaurierung der Insterburg begonnen. Vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war die Bevölkerung auf 49.000 Einwohner angewachsen.
Am 27. Juli 1944 wurde Insterburg durch einen sowjetischen Bombenangriff erheblich zerstört. 120 Tote waren zu beklagen, obwohl der Kern der Altstadt mit besonders leicht brennbaren Häusern schon geräumt worden war. Von da an wurde die Stadt schrittweise weiter evakuiert, besonders ab dem zeitweisen Einbruch der Roten Armee bei Goldap im Oktober 1944. Anfang Januar 1945 befanden sich noch 8.000 bis 10.000 Insterburger in der Stadt, vorwiegend solche mit Funktionen in noch nicht evakuierten Betrieben und Institutionen. Am 13. Januar 1945 begann die sowjetische Großoffensive in Ostpreußen. Einem schweren Luftangriff am 20. Januar fielen noch einmal 30 Zivilisten zum Opfer. Von da an lag die weitgehend geräumte Stadt unter ständigem Beschuss durch Tiefflieger und Artillerie. Der letzte Zug verließ Insterburg am 22. Januar 1945 um 0:30 Uhr. Quelle: http://doku.zentrum-gegen-vertreibung.de/archiv/oderneisse1/kapitel-6-1-1-1-5.htm
Hildegard Kiehl fährt fort:
- Im Herbst 1944 mussten auch große Teile der Landbevölkerung die Heimat verlassen. Sämtliche Kühe wurden zu großen Herden zusammengetrieben, und weiter in den Westen sollte es gehen; was wir aber nicht glaubten! Ich höre heute noch das verzweifelte Brüllen der Tiere und unsere älteste Kuh stand eines Tages vor dem Stall auf dem Hof. Sie war heimgekehrt, und wir haben sie behalten. Pferde durften bleiben; denn der Flüchtlingstreck ging mit Pferd und Wagen in den Kreis Mohrungen in Ostpreußen. Der größte Kastenwagen wurde mit einer Plane überspannt und mit Hab und Gut, so viel hineinging, beladen. Unser Termin war der 15. November 1944. Doch plötzlich wurde Vater wieder sehr krank. Er hätte wohl den langen Treck mit der großen Aufregung nicht überstanden. So beschlossen wir, noch etwas Daheim zu bleiben. Vom 21. 10. – 1. 11. 1944 wurde die Räumung des Kreisgebietes Insterburg (teilweise) von der Zivilbevölkerung angeordnet. Aufnahmekreis ist der Landkreis Mohrungen. Unser Michael war noch immer bei uns. Noch einmal, zum letzten Male in unserem Leben, haben wir Weihnachten zuhause erlebt, mit einem kleinen Weihnachtsbaum — es war sehr traurig. Michael versprach Vater, auf alles zu achten; denn er wollte in Wilkental wohnen bleiben. Feldpost kam auch nicht mehr. Unsere Wehrmacht war auf dem Rückmarsch. Unser Plan war, mit der Bahn nach Königsberg, in die leerstehende Wohnung von Tante Friedel und weiter bis über die Weichsel ( ... denn es war eine Hoffnung, daß der Russe dort zum Stillstand käme!).
Flucht
- Unsere Flucht aus Ostpreußen stand bevor. "Dann in Gottes Namen!" Vater weinte. So packten wir nur Handgepäck, soviel wir schleppen konnten. Alles wurde auf einen kleinen Kasten Wagen geladen, Michael spannte beide Pferde davor und fuhr am Wohnhaus vor. Vater und Mutter gingen noch einmal durchs Wohnhaus, Stall und Scheune, schlossen alles ab und stiegen zu Michael und mir in den Wagen. Die Schlüssel übergab Vater an Michael. Vater nahm Michael die Leine ab, sagte: „Dann in Gottes Namen!" Vater trieb die Pferde an; und wir fuhren von unserem geliebten Hof und Grundstück zur Bahnstation Grünheide. Es war der 10 Januar 1945. Die Flucht begann. Wer nach Westen wollte, brauchte eine Reisegenehmigung, um Fahrkarten für einen der wenigen noch verkehrenden Züge zu erwerben.
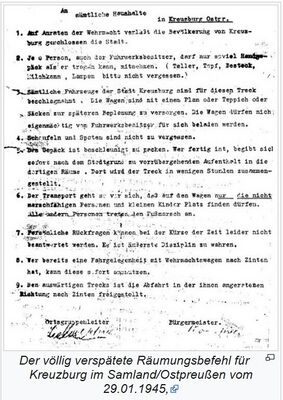

- Auf dem Bahnhof nahm Vater Michael in den Arm, uns allen liefen die Tränen; wir stiegen in den Zug in Richtung Insterburg und von hier aus ging es nach Königsberg weiter. In Königsberg kamen wir in der Wohnung meiner Schwester Friedel, trotz Fliegeralarm, etwas zur Ruhe. Das Zweifamilienhaus war Kasernengelände und vor der Stadt gelegen. Mein Schwager war Hausmeister in der Kaserne, zusammen mit einem zweiten, der in demselben Haus wohnte — und dieser war noch da, während mein Schwager an der Front war.
- Die Freude war groß — aber nicht zu lange! Einmal bin ich noch nach Hause gefahren. Die Eisenbahn fuhr nur teilweise, viele Brücken waren zerstört. Unser Michael, der weißrussische Knecht, war nicht mehr da. Auch Lisa und Mona, unsere treuen Kühe, war weg. In der Veranda lag unser Hofhund Lux, aber erschlagen. Die Haustür aufgebrochen; aber das Haus war nicht ausgeräumt. Viele Einheiten von deutschen Soldaten hatten sich in der Umgebung niedergelassen, die auf dem Rückzug waren. Auch Opas Einheit war dabei, allerdings einige Kilometer entfernt. Sie alle schützten unser Hab und Gut vor Plünderungen, so gut es ging. Der Russe plante weitere Großangriffe, die kamen dann auch, es war ein bitterkalter Winter mit 20 Grad minus und mehr und viel Schnee.

Weitere Hintergrundinformation zur Evakuierung Ostpreußens : „Die Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa“, in Verbindung mit Adolf Diestelkamp, Rudolf Laun, Peter Rassow und Hans Rothfels bearbeitet von Theodor Schieder, [84]
Die Königsberger Bevölkerung war zunächst mit Eisenbahnzügen geflohen, bis der Zugverkehr nach dem Reich am 21. Januar 1945 aufhörte. Danach hatten sich große Teile nach Pillau begeben, um von dort aus entweder über die Nehrung nach Westen zu gelangen oder über See ins Reich abtransportiert zu werden. Als Ende Januar 1945 die Einschließung der Stadt vollendet war, wurden noch geringe Teile der Bevölkerung zu Schiff von Königsberg nach Pillau gebracht, und Mitte Februar, nachdem im Norden der Stadt die Verbindung nach dem Samland für einige Wochen wieder freigekämpft war, konnten noch weitere Teile der Zivilbevölkerung aus Königsberg ins Samland übergeführt werden. Dennoch blieben ca. 100 000 Menschen in Königsberg zurück. Viele von ihnen kamen den Räumungsaufforderungen der Partei absichtlich nicht nach, weil sie sich in der Stadt sicherer glaubten als im Samland oder auf dem gefahrvollen Fluchtweg über Pillau. Fortgesetzte Bombenabwürfe und Artilleriebeschuss auf Königsberg zerstörten während der Wochen der Einschließung einen großen Teil der ohnehin durch Luftangriffe schon früher schwer mitgenommenen Stadt und richteten unter der nur noch in Kellern lebenden Zivilbevölkerung hohe Verluste an. Als schließlich am 6. bis 9. April der Generalangriff der Roten Armee auf Königsberg erfolgte, wurden nochmals viele Zivilisten in die Kriegsereignisse hineingerissen. Ca. 25 Prozent der in Königsberg verbliebenen Bevölkerung waren im Laufe der Kampfhandlungen ums Leben gekommen, als am 9. April die Stadt an die Russen übergeben wurde.
Als letzte Bastion in Ostpreußen blieb nunmehr nur noch der Streifen entlang der Samlandküste und der Raum um Pillau—Fischhausen in deutscher Hand. Noch immer betrug die Zahl der aus Königsberg, dem Samland und aus weiter östlich gelegenen Kreisen in Pillau, Fischhausen, Palmnicken, Rauschen und Neukuhren untergebrachten Menschen viele Tausende, obwohl die Hauptmasse der Flüchtlinge bereits von Pillau aus über See abtransportiert worden war. Die ersten mit Flüchtlingen beladenen Schiffe hatten am 25. Januar Pillau verlassen, und am 15. Februar konnte in Pillau bereits registriert werden, daß 204.000 Flüchtlinge mit Schiffen abbefördert und weitere 50000 nach Neutief übergesetzt und im Treck oder Fußmarsch auf der Frischen Nehrung weitergeleitet worden waren. Aber noch immer strömten viele Tausende nach Pillau. Sie kamen nicht nur über Land, sondern auch von Neukuhren aus mit kleinen Schiffen an. Die Stadt beherbergte an manchen Tagen über 75.000 Menschen, unter denen die ständigen sowjetischen Fliegerangriffe hohe Verluste anrichteten. Allein in der Zeit von Anfang März bis Mitte April fanden 13 schwere Luftangriffe auf Pillau statt, während gleichzeitig auch sowjetische Artillerie Stadt und Hafen beschoss.
Vom 8. März an musste für ca. drei Wochen der Abtransport von Flüchtlingen aus Pillau eingestellt werden, weil aller zur Verfügung stehende Schiffsraum in dieser Zeit zum Abtransport der Flüchtlinge aus den Städten Danzig und Gdingen benötigt wurde, denen in Kürze die Einnahme durch sowjetische Truppen drohte. In dieser Zeit, als keine Schiffe von Pillau abfuhren, zogen viele Tausende nach Neutief herüber und die Nehrung entlang, denn von der Danziger Niederung aus verkehrten auch nach der Einnahme Danzigs noch Fährprähme nach Hela, von wo aus dann der Weitertransport ins Reich erfolgen konnte. Ab Ende März wurde der Schiffsverkehr von Pillau aus nach dem Westen wieder aufgenommen. [85]
- Wehrmachtssoldaten in Willkental
Soldaten der Wehrmacht in Wilkental auf dem Hof
von Bürgermeister Mikuteit (1944) [86]Soldaten in Wilkental vor dem Hof von Ferdinand Tuttlies ?
(1944) [87]
Die bekannteste Zahlenangabe in der Literatur zur Vertreibung besagt, dass rund zwei Millionen Deutsche insgesamt infolge der Vertreibung umgekommen seien. Hans-Ulrich Wehler schätzt, dass während der Flucht, Vertreibung oder Zwangsumsiedlung 1,71 Millionen Deutsche ums Leben kamen. Der Kirchliche Suchdienst und das Bundesarchiv kamen 1965 und 1974 unabhängig voneinander mit Einzelfallrecherchen auf 500.000 bis 600.000 bestätigte Toten in unmittelbarer Folge der Verbrechen im Zusammenhang mit der Vertreibung. Unter allen deutschen Ländern hatte Ostpreußen im Zweiten Weltkrieg die meisten Verluste erlitten: Von seinen fast 2,5 Mio. Einwohnern fielen 511.000 Menschen (darunter 311.000 Zivilisten) im Kampf, auf der Flucht, durch Verschleppung und Lagerinternierung sowie dem Hunger und der Kälte zum Opfer. [88]

Auch der Gauleiter von Ostpreußen Erich Koch begab sich auf die Flucht. Erich Koch floh am 24. April 1945 mit einem Flugzeug von Pillau-Neutief auf die Halbinsel Hela, von wo er auf dem eigens für ihn extra bereitgehaltenen Hochsee-Eisbrecher "Ostpreußen" am 27. April 1945 vor den vorrückenden Truppen der Roten Armee über die Ostsee entkommen konnte. Am 29. April 1945 erreichte er Saßnitz, das ebenfalls schon von der Roten Armee bedroht wurde, am 30. April 1945 Kopenhagen und am 5. Mai 1945 Flensburg. Dort nahm er eine neue Identität an, indem er sich falsche Papiere ausstellen ließ. Sein „ Hitlerbärtchen” rasierte er ab, zudem trug er nun zur Tarnung eine Brille.” 1949 wurde er verhaftet und an Polen ausgeliefert. 1986 starb er dort im Gefängnis. [90]
- Hildegard Tuttlies berichtet weiter:
- In Königsberg kam der Bescheid, dass die Stadt sofort von Zivilisten geräumt werden müsste. Dieses Mal sollte es per Schiff weitergehen. Unser Nachbar brachte uns zum Königsberger Hafen. Hier lag ein Riesenschiff vor Anker (den Namen weiß ich nicht mehr), im Begriff auszulaufen. Die Zugangsbrücke war schon eingefahren, aber an Strickleitern zogen sich Flüchtlinge noch eilig an Bord, und wir sollten auch hoch — aber Uropa und -Oma wehrten sich dagegen. Und das war unser Glück! Das so überladene Schiff bekam auf hoher See einen Volltreffer und ist mit Mann und Maus gesunken! Und nun kam der gefürchtete Fliegeralarm. Wir liefen in einen Bunker, es ging alles glimpflich ab. Plötzlich tauchten deutsche Soldaten auf. Sie trennten die Männer von ihren Familien, sie sollten zur Verteidigung der Stadt zurückbleiben, so auch mein Vater — und das mit 76 Jahren! Frauen und Kinder mussten geschwinde aus dem Bunker, wir wurden mit der Menschenmasse nach draußen gedrängt, Vater blieb fassungslos zurück!
Abschied von der Heimat!
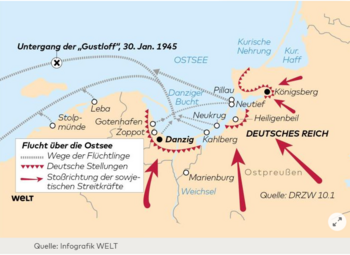
- In großen Militärtransportern ging es zum Nordbahnhof, von hier dann mit dem Zug nach Pillau, in den nächsten Seehafen; vom Bahnhof dann bis zum Hafen mit unserem schweren Gepäck zu Fuß. Ich hatte einen großen Koffer — mit Schinken und Speck und noch einen zweiten Koffer mit Bekleidung. Es war ja tiefer Winter... Ich packte beide Koffer übereinander, zurrte sie mit langen Riemen sehr fest und schleppte sie im Schnee und Eis hinter mir her. Mutter hatte einen Riesenmarmeladeneimer voller Schweineschmalz und eine große Tasche dazu gepackt.
- Bei Vater war ein Rucksack mit Würsten und eine Tasche mit Zeug zum Anziehen. Er hatte seinen großen Fahrpelz über seine Bekleidung gezogen, dazu Pelz-Mütze und Pelz-Handschuhe, also frieren konnte er nicht! Was er aber immer - auch auf der Flucht - bis zu seinem Lebensende dabeihatte und regelmäßig daraus vorlas war: Tägliches Hand-Buch in guten und bösen Tagen in Aufmunterungen, Gebeten und Gesängen, Sprüchen und Seufzer für Gesunde, für Betrübte, für Kranke, für Sterbende nebst Andachten von Johann Friedrich Strak, Evangelischer Prediger, 165. Auflage. Es war das Hochzeitsgeschenk der Eltern meiner Mutter am 14. November 1902.
- Auch Mutter hatte ihren Pelz an. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine lange Hose an, die Trainingshose von meinem Bruder und trug eine Pelz-Weste.
- Im Hafen von Pillau kamen wir nach großem Gedränge und sechs Stunden ungeduldigem Wartens und endlich auf ein kleines Seesicherungsboot. Alle wollten mit. Die größte Teil auf dem Boot waren Frauen und Kinder. Von den wenigen Männern, die wir sahen, gehörten, nach deren Kleidung zu urteilen, einige wohl zu den Wohlhabenden. Sie trugen z. B. elegante Pelzmäntel. Manche Männer wurden von Uniformierten vor unseren Augen aus der Menge gezerrt. Bei ihnen wurden noch an Land, so konnten wir jedenfalls beobachten, die Papiere genau kontrolliert. Wahrscheinlich, so hieß es, suchte man immer noch nach feigen „Parteibonzen“, die die "Durchhalte-Befehle" von Gauleiter Koch missachteten. Die Frauen und die Kindern wurden nicht kontrolliert – es waren ja auch zu viele. Ob das überall im Hafen so ablief, weiß ich nicht. Dicht zusammengezwängt hocken wir schließlich draußen an Deck des Bootes. Der geschlossene Fahrstand war nur für die Matrosen und schwangere Frauen vorgesehen. Er bot aber auch ein wenig Windschutz für die „Decksleute“. Mutter saß auf dem Schmalzeimer, ich mit einer jungen Frau zusammen auf meinen Koffern in einer Bootsecke. Unsere erste „Seereise“ im Leben verlief von Pillau nach Stettin. (ca. 220 Seemeilen) im Freien. Es war windig, sehr kalt und es schneite. Alle rücken eng zusammen. Wir waren froh, dass wir Pelz-Handschuhe und Pelz-Mützen dabeihatten. Zum Glück gab es auch einige Wehrmachts-Decken an Bord, die verteilt wurden. Einige Flüchtlinge wurden während der Fahrt seekrank, wir aber nicht, die Angst war wohl zu groß. Wir waren einen halben Tag und eine lange Nacht auf See - eine schreckliche Ewigkeit für uns. Gegessen haben wir nichts, es gab aber Wasser zu trinken. Zwischendurch blieb das Boot manchmal ruhig liegen, der Motor wurde abgestellt. Keiner wusste warum. Die fünf Matrosen sprachen nicht mit uns. Sofort kamen Gerüchte auf: feindliches U-Boot, treibenden Minen, kein Treibstoff, Motor kaputt. Gott sei Dank, wir kamen, trotz mehrfachen Fliegeralarm, heil in Stettin an. Alle Wehrmachts-Decken mussten aber vor Ankunft wieder eingesammelt werden. Die Matrosen achteten sehr streng auf die Abgabe, dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten mit einigen Frauen. Ein paar Decken landeten mutwillig im Wasser. Unser Landungsboot machte direkt neben dem noch intakten Stettiner Hauptbahnhof fest. Endlich an Land in Stettin umarmten sich die beiden Tuttliesen Frauen. Das Meer blieb uns sehr unheimlich, Mutter und ich waren als Landbewohner dazu auch noch Nichtschwimmer.
Nach der Offensive der Roten Armee im Januar 1945 war Ostpreußen abgeschnitten. Die Bevölkerung war zunächst mit Eisenbahnzügen geflohen, bis der Zugverkehr nach dem Reich am 21. Januar aufhörte. Die Menschen konnten nur noch über die Ostsee fliehen. Etwa 350 größere Schiffe beteiligten sich an der Aktion. Alle Schiffstypen wurden verwendet, z. B. Kriegsschiffe, Truppentransporte, Landungsboote, Frachter, Fischerboote, Schlepper und Tanker. Zivile Schiffe bekamen ein Marinekommando. Der Verlust von insgesamt zwölf großem Schiffen und eine unbekannte Zahl von kleineren Schiffen im Rahmen dieser Transporte durch Torpedos der russische Marine und Luftwaffen Angriffe kostete ca. 22.000 Menschen das Leben, darunter die Wilhelm Gustloff, abgelegt in Gotenhafen am 30. Januar 1945 (zwischen 4.000 bis 9.000 Ertrunkene) und der Frachter Goya abgelegt in Hela am 16. April 1945 (mehr als 7.000 Ertrunkene).
Die deutsche Kriegsmarine versorgte die eingekesselten Gebiete im Osten über die Häfen bis zum Mai 1945 mit Soldaten, Munition und Material und transportierte auf dem Rückweg insgesamt eine halbe Million Verwundete ab. Hinzu kamen Kriegsgüter und Waffen, die in den durch den Stellungskrieg geprägten schrumpfenden Kesseln nicht mehr verwendet werden konnten. Die Mitnahme von Zivilisten wurde durch Großadmiral Dönitz lediglich geduldet – und zwar nur, soweit die militärischen Erfordernisse es zuließen. Am 6. April definierte die Kriegsmarine den Transportschlüssel wie folgt: 80 % der Kapazitäten sollten für Verwundetentransporte und weitere militärische Zwecke und 20 % für Zivilisten zur Verfügung stehen. Nach der Kapitulation Königsbergs am 9. April wurde letzterer Anteil auf 40 % erhöht
Die Wilhelm Gustloff war ein Kabinen-Fahrgastschiff der NS-Organisation Deutsche Arbeitsfront (DAF), dessen Versenkung wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa als eine der verlustreichsten Katastrophen der Seefahrt gilt.
Das Motorschiff wurde ab Frühjahr 1938 vom Amt für Reisen, Wandern und Urlaub (RWU) der DAF-Unterorganisation NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (KdF) für Kreuzfahrten eingesetzt. Nach Kriegsbeginn am 1. September 1939 wurde es, wie die anderen KdF-Schiffe auch, von der Kriegsmarine als Lazarettschiff, Wohnschiff und Truppentransporter verwendet. Am 30. Januar 1945 wurde die mit Flüchtlingen und Wehrmachtsangehörigen überfüllte Gustloff vor der Küste Pommerns von dem sowjetischen U-Boot S-13 torpediert. Bei der Versenkung kamen je nach Schätzung zwischen 4.000 und mehr als 9.000 Menschen ums Leben.
- Flucht über die Ostsee
Hafen von Pillau (1930) [92]
Verladung in Pillau (1945) Bundesarchiv Bild 146-1989-033-33 [93]
Flucht über die Ostsee (1945) Bundesarchiv Bild 146-1972-092-05 [94]
Wilhelm Gustloff als Sanitätsschiff in Stettin, 1939 [95]
Nach dem Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 stellte sich das Problem der Breitspur der russischen Eisenbahn. Die deutschen Planungen hatten das russische Eisenbahnnetz in ihren Planungen einbezogen. Entgegen den Erwartungen war es den Russischen Eisenbahner und Truppen gelungen, einen Großteil des Rollmaterials bei ihrem Rückzug mitzuführen oder unbrauchbar zu machen. Erschwerend kam hinzu, es war insbesondere wegen der langen Strecken nicht möglich, den Materialtransport wie zunächst vorgesehen vorwiegend mit Straßenfahrzeugen durchzuführen. Um regelspurige Fahrzeuge einsetzen zu können, musste die Breitspur auf Regelspur um gespurt werden.
Der Aufwand war trotz der auf Holzschwellen genagelten Gleise enorm. Beachtlich waren die Leistung der Angehörigen der Deutschen Reichsbahn und den Eisenbahntruppen der Wehrmacht. Es gelang Ihnen, zwischen dem 22. Juni und 8. Oktober 1941 insgesamt 16.148 Kilometer der sowjetischen Gleisanlagen auf Regelspur umzubauen. Wegen der Standsicherheit von Dämmen wurde auf zweigleisigen Strecken in der Regel der äußere Strang versetzt. Weichen mussten, beginnend beim Herzstück mit Längenänderungen im Zwischenschienenbereich neu auf gemessen werden. Die Logistik der Reichsbahn war von entscheidender Bedeutung für die Durchführung der Angriffskriege. Die Vorbereitung zum Überfall auf die Sowjetunion sollte die größte Kapazitätsausweitung in der Geschichte der Deutschen Reichsbahn werden. Ostpreußen wurde zur wichtigen Transitprovinz für den Eisenbahnverkehr der deutschen Wehrmacht nach Russland. Dabei wurde der Eisenbahnknoten Insterburg stark ausgebaut, mit den weiterführenden Strecken zu den Grenzstationen Tilsit und Eydtkuhnen.
Bei der Vernichtung der Juden war die Logistik der Reichsbahn ebenfalls ein wichtiger Baustein. Zugtransporte der jüdischen Menschen in die Konzentrations- und Vernichtungslager erfolgten dabei meist wie andere Massenpersonentransporte (v. a. von Soldaten beim Truppenaufmarsch) in gedeckten Güterwagen, was als zusätzliche Erniedrigung empfunden wurde. Die Wagen wurden jedoch im Gegensatz zu Truppentransporten mit deutlich mehr Personen belegt, was die Rentabilität der Transporte hob. In der Regel wurden die Güterwagen mit 60 - 100 Menschen beladen, manchmal sogar darüber. So dauerte z. B. die Fahrt von Berlin nach Auschwitz etwa 8 - 10 Tage. Schätzungsweise wurden 2,7 Mio. Juden von der Reichsbahn in die Vernichtungslager nach Polen transportiert.
Im März 1945 standen die Truppen der Westalliierten bereits an Rhein und Mosel, die Rote Armee erreichte Pommern. In Berlin wurde der Jahrgang 1929 zur Wehrmacht einberufen, die Soldaten waren 15 Jahre alt. Im Bunker unter der Reichskanzlei unterzeichnete Adolf Hitler einen seiner letzten Erlasse. „Der Kampf um die Existenz unseres Volkes“, heißt es darin, „zwingt zur Ausnutzung aller Mittel, die die Kampfkraft unseres Feindes schwächen und sein weiteres Vordringen behindern. (…) Ich befehle daher: Alle militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind zur Fortsetzung seines Kampfes nutzbar machen kann, sind zu zerstören.“
Dieser Erlass wurde als „Nero-Befehl“ bezeichnet. Befolgt wurde er von Teilen der Wehrmacht. Sie setzte auf ihrem Rückzug den „Schienenwolf“ ein, ein Spezialgerät, das an den Schluss eines Zuges angehangen wurde, um das Gleis unbrauchbar zu machen. Der „Nero-Befehl“ wurde von den Eisenbahnern kaum befolgt. Sie wollten ihre möglichen Arbeitsplätze nicht selber zerstören. Bahnanlagen gehörten zu den Hauptangriffszielen der alliierten Luftangriffe. Immer mehr Schäden waren zu reparieren, Linien waren durch zerstörtes Wagenmaterial blockiert. Im Januar 1945 hatte die Reichsbahn den zivilen Schnellzugverkehr eingestellt. Die Reichsbahn war fast nur noch für die an allen Fronten zurückweichende Wehrmacht da und für die Flucht der Bevölkerung aus dem Osten.
- Ab Stettin ging es mit der Bahn quer durch Deutschland nach Chemnitz und weiter nach Lugau im Erzgebirge zu Tante Friedel und ihren Kindern. Das Ziel hatten wir uns schon zu Hause vorgenommen.
- Die Bahnfahrt im Güterzug hat fast acht Tage gedauert. Wir hatten oft Fliegerbeschuß, mussten dann ganz schnell aus dem Zug heraus, uns in Büschen und Gräben verstecken. Wenn die Gefahr vorbei war, pfiff der Zug — alles rannte wieder zum Zug — und weiter ging es. Des Nachts standen alle Räder still. Mich wunderte es nur, dass wir immer wieder unseren wertvollen Schmalzeimer und den Speckkoffer vorfanden. Aber wieder „Gott sei Dank..."! Es ging alles gut — und dann standen wir vor der Tür von Tante Friedel, es war früh an einem Morgen. Müde, dreckig, hungrig, alles verloren, ohne unseren Vater. Es war ein trauriges Wiedersehen.
- Flucht mit der Reichsbahn und Transport in die Vernichtungslager
Flüchtlinge im offenen Güterwagen (1945) [96]
Flüchtlinge im Zug von Stettin nach Lübeck (1945) [97]
Ankommende und abfahrende Flüchtlinge am Bahnhof in Bamberg nach Kriegsende [98]
Mit Güter-Wagens dieser Art wurden während des Holocausts etwa 2,7 Mio. Menschen in die Vernichtungslager nach Polen transportiert. Denkmal zur Erinnerung an die Deportierten, Schoah-Gedenkstätte Yad Vashem, Mai 2004 [99]
Im Januar 1945 waren von den ursprünglich 2.350.000 Bewohnern noch 1.850.000 Menschen in Ostpreußen. Ab Januar 1945 konnten noch 250.000 Ostpreußen aus dem Landweg (Treck oder Eisenbahn) fliehen, per Schiff wurden 1,1 Mio. Menschen evakuiert. 500.000 Ostpreußen fielen in russische Hände.
- Allmählich lebten wir uns in Lugau ein; trotz der großen Flüchtlingszahl — und der sehr knappen Verpflegung auf Lebensmittelkarten, obwohl wir immer noch etwas aus unserem Mitbringsel zuzusetzen hatten. Es gab keinen Fliegeralarm, dafür sehr viele Russen als Besatzung; man ging ihnen aus dem Wege und so blieb man ungeschoren! So konnten wir wenigstens in der uns zugewiesenen Bodenkammer lange und ruhig schlafen, um vielleicht eine Mahlzeit einzusparen; denn unsere Vorräte wurden immer weniger. Dazu kam das bange Warten auf Nachricht von meinem lieben Gerhard, meinem Vater, meinem Bruder, meinem Schwager, dem Mann meiner lieben Schwester.
Der 8. Mai 1945
- Und dann kam der große Tag — 8. Mai 1945, „Tag der Kapitulation". Meine Mutter und ich standen draußen am Hofzaun, schauten ins weite Land und weinten, weinten. Wir hatten Heimweh nach unserem Ostpreußen und Sehnsucht nach unseren Lieben. Ob sie noch am Leben waren? Dazu die bange Frage, was sollen wir kochen, wieder eine Wassersuppe von Rübenblättern, die wir von den Feldern stibitzten, oder vielleicht lieber „Spinat von Brennnesseln" mit nichts drin?
- So verging die Zeit... Mai und Juni war auch fast vorbei — und dann kam sie, die lang ersehnte Nachricht von meinem lieben Mann, Eurem Opa! Den Brief mit der vertrauten Schrift hielt ich lange in den Händen. Ich wagte ihn kaum zu öffnen, ging nach draußen, setzte mich in eine stille Wiesenecke und habe den Brief geöffnet! „ Mollhagen bei Trittau in Holstein", stand neben dem Datum. Er schrieb mir, dass er gesund den furchtbaren Krieg überstanden habe und dass er in Mollhagen bei Trittau bei einem Großbauern untergebracht war. Er arbeitete dort in dessen Forst - dem späteren Naturschutzgebiet Hahn Heide. Er war dort mit der Organisation und Beaufsichtigung von Forst-Bereiche (Jagen) für den Holzeinschlag beschäftigt. Er hoffe nur, dass ich mit meinem Lieben alles gut überstanden hätte und dass wir uns recht bald in Mollhagen wiedersehen mögen. Tante Friedels Anschrift aus Lugau hatte er nach unserer Abreise aus Königsberg zufällig in der unbewohnten Wohnung gefunden! „Glück muss der Mensch haben!"
- Ich fuhr dann sofort zu Eurem Opa. Ab Chemnitz nach Hamburg im offenen Güterzug. Es war Sommer, die Sonne schien und uns stand das Wiedersehen bevor! In Trittau (Schleswig-Holstein) trafen wir uns. Ein halbes Jahr ohne Nachricht waren wir; und ich war so schüchtern ihm gegenüber — er aber auch!

- Es gab kein jauchzendes Wiedersehen; sondern leise weinend lagen wir uns in den Armen. Dann ging es mit einem Dienstwagen nach Mollhagen, unserer Unterkunft. Es war ein großer Bauernhof mit einem schönen geräumigen Wohnhaus. Über die Diele gelangte man zur Treppe nach oben in unser Zimmer.
- Es war klein und ärmlich möbliert. Ein breites Bett mit einer Strohschütte, darüber eine alte Decke, ein gebrauchtes Kopfkissen und eine zweite Decke zum Zudecken (ohne Bettwäsche!). Dann ein winziger Tisch und zwei verdreckte Gartenstühle, eine Kochhexe und ein Brett als Ablage für einen Eimer, einen alten Kochtopf, zwei Teller, zwei Löffel, zwei Gabeln und Messer und zwei Becher! „Na, gode Morje — ös dat alles?" sagte wütend Euer Opa! Aber zwischen den zwei Fenstern hing ein riesiger Wandspiegel von der Decke bis zum Erdboden!
- Die Wirtsleute verhielten sich sehr reserviert — wir aber auch! Wir waren ja Flüchtlinge aus Ostpreußen, die angeblich sogar für den Krieg verantwortlich sein sollten. „Vielleicht kommen DIE sogar aus Polen...", hieß es von unserem Gastgeber, dem Herrn ehem. „Ortsbauernführer"! Über unsere Schwelle kam der Bauer nie. Wenn er uns großzügig mal ein trocknes Brot zukommen ließ, riss er die Türe auf und warf es uns zu!!! Wir bedankten uns überschwänglich und lachten dabei! Das stand bei uns fest, unsere Bleibe war dort nur von kurzer Dauer! Wir waren glücklich, nachdem wir uns wieder aneinander gewöhnt hatten. Der Krieg war vorbei — wir waren jung und gesund und hatten die Zukunft, ganz gleich wie, vor uns! Über die erste Bettwäsche auf Bezugsschein haben wir uns riesig gefreut!
- Ich betätigte ich mich jede Woche einmal beim Hausputz. Dann stand der Altbauer, ihr Vater, mit Spazierstock Schmiere, ob ich auch alles gut machte! Ich feudelte dann wie wild um ihn herum, und jedes Mal rief er: „Aufhören! Von Juli 1945 bis April 1946 blieben wir in Mollhagen.
- Opa hatte schon vorher begonnen sich wegzubewerben, was unter den damaligen Verhältnissen nicht einfach war, Papier, Schreibgerät, Umschläge und Briefmarken mussten umständlich besorgt werden und die Post funktionierte nur unregelmäßig.
Neuanfang
- In unserem gemeinsamen Leben ist aber alles gut gegangen. Mein Mann und ich hatten immer einen Schutzengel, und ich bin unserem Herrgott dankbar, dass wir fast 55 Ehejahre gemeinsam erleben durften.
Neubeginn beim Zoll
- Euer Opa hatte sich schon von Anfang 1946 an, u.a. bei den deutschen Behörden, die neu eingerichtet wurden, beworben. Ein Offizier aus dem englischen Vermittlungsdienst in Trittau hatte ihn auf den Zollgrenzschutz hingewiesen. "They are looking for new staff". Opa hatte sich die Adresse aufgeschrieben und seine Bewerbung losgeschickt. Nach 8 Wochen kam eine positive Antwort
Einschub: Mit Kriegsende übernahmen die in der Britischen Besatzungszone stationierten alliierten Truppen (darunter Briten, Kanadier und Polen) die Grenzkontrolle und errichteten in Grenznähe eine Sperrzone, die auch alle ehemaligen deutschen Zöllner verlassen mussten. Die wiedererrichtete deutsche Finanzverwaltung erhielt schon Ende 1945 den Auftrag, geeignetes neues Personal für die Grenzbewachung in der Sperrzone auszuwählen. Aufgaben waren unter anderem die reguläre Grenzabfertigung, der Streifendienst unter Aufsicht des britischen Field Security Service (FSS) sowie Durchsuchung und Festnahme von Personen bei illegalen Grenzübertritten. Im März 1946 übernahm der deutsche Zollgrenzschutz die Verantwortung für die Grenze. Mit Wirkung vom 1. Juni 1946 wurde der Zollgrenzschutz aus der Finanzverwaltung herausgelöst und dem britischen Frontier Control Service (FCS) mit Sitz in Oldenburg unterstellt, der seine Weisungen direkt von der Militärregierung in Berlin erhielt. Als deutscher Vorgesetzter fungierte der Chefinspektor des Zollgrenzschutzes in Oldenburg (1948 nach Cuxhaven verlegt). Ihm unterstanden die besatzungszonenweite Inspektionen des Zollgrenzschutzes, die überörtlichen Hauptzollämter, die örtlichen Kommissariate, die lokalen Grenzaufsichtsstellen, die Grenzübergänge vor Ort und die acht Zollschiffstationen. Den Dienststellen waren jeweils britische Angehörige des FCS zur externen Kontrolle zugeordnet. Am 1. April 1949 trat in der Bizone das Gesetz über die Zoll-Leitstelle und den Zollgrenzdienst in Kraft. Damit endete die Bezeichnung Zollgrenzschutz, Die alte Bezeichnung (Zoll-) Grenzaufsichtsdienst wurde nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 wieder eingeführt. Die deutschen Grenzaufsichtsbeamten hatten innerhalb der räumlich definierten Zollgrenzgebiete Polizeirechte, wie z.B. die der Ermittlung, der Durchsuchung, der Festnahme, der Inhaftierung und der Überstellung von gefassten Schmugglern an die Staatsanwaltschaft. In den Grenzzollämter waren zur Inhaftierung von gefassten Schmuggler vergitterte Räume eingerichtet worden.
Quelle: https://www.zollgrenzschutz.de/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=362
- Unterstützung und Einstellung
Gerhard Kiehl - Gewährung von Unterstützung, 1945 [101]
Benachrichtigungstelegramm über Einstellung von Gerhard Kiehl beim Zollgrenzschutz (1946) [102]

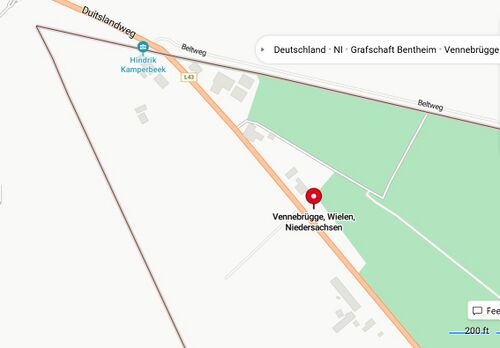
Hildegard Kiehl berichtet weiter:
- Am 10. April 1946 bekam Gerhard Kiehl, Euer Opa ein Telegramm zur Einstellung zunächst als Angestellter beim Zollgrenzschutz als Zollassistent zum 14. April 1946 in der Grenzaufsichtsstelle (GASt) Vennebrügge, Gemeinde Wielen, Landkreis Grafschaft Bentheim in Niedersachsen an der holländischen Grenze - mit einer Dienstwohnung. Was waren wir froh!!! Die Grafschaft ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, im Norden (in der Niedergrafschaft) befinden sich große Moor- und Heidegebiete, im Süden (in der Obergrafschaft) erstreckt sich mit dem Bentheimer Berg ein Ausläufer des Teutoburger Waldes. Es ist etwa 90 Meter hoch. Zwei Tage und eine Nacht waren wir von Trittau – von Mollhagen aus die nächste Bahnstation bis Neuenhaus - der letzten Bahnstation vor der holländischen Grenze - nach Vennebrügge unterwegs. Des Nachts standen alle Räder still, die Bahnhöfe blieben aber geöffnet.
- Wir hatten in zwei Rucksäcken alles eingepackt, was wir noch besaßen. Außerdem schleppten wir noch zwei Decken, einen dicken Wehrmachtsmantel, dazu noch zwei Paar Knobelbecher mit. Damit wir wussten, wo wir hinsollten, hatte Opa uns eine Landkarte aus einem alte Schulatlas "besorgt", die aber noch stimmte. Die letzten 12 km ging es per Anhalter — nur mit Pferdefuhrwerken — und zu Fuß weiter! Die Welt war dort zu Ende und die Zeit wohl stehen geblieben!
- Vennebrügge war ein winziger Grenzort mit den drei deutsch-holländischen Bauern Kampherbeek, Stegink, Schulding. Es gab dort ein offizielles Zollamt für den Grenzverkehr mit Holland. Es war vor dem Krieg neu erbaut worden. Im Zollamtsgebäude gab es zwei Wohnungen für die beiden dort tätigen Zollbeamten und ihren Familien, dem Zollamtsvorsteher und einem Zollwachmeister. Die Beamten leisteten ihren Dienst bei der regulären Grenzabfertigung von Personen und Gütern. Diese war zwischen 7:00 und 19:00 Uhr möglich. Zur Kontrollen von LKWs und Anhängern gab es eine Rampe. Manchmal wurden auch extra ausgebildete Spürhunde eingesetzt. Das Zollamt war zwar organisatorisch vom Zollgrenzschutz getrennt, es gab aber eine gegenseitige Personalhilfe bei Lehrgängen, Urlauben und Krankheiten.
- Das Zollamt lag zwischen den Höfen Kampherbeek und Stegink direkt an der Grenze, der Hof von Schulding ein kleines Stück weiter landeinwärts. Alle drei Bauern hatten enge wirtschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen über die Grenze nach Holland. So hatten sie z. B. in Holland auch eigenen Landbesitz, ihre Kinder gingen dort auch zu Schule. Weiter gab es in Vennebrügge ein Zollgrenzschutzbeamtenhaus für die Grenzschutzbeamten mit drei Wohnungen. Das Haus musste aber erst wieder in Stand gesetzt werden, denn es war nach Kriegsende ausgeräubert worden.
- Nach der Meldung beim Zollamtsvorsteher begleitete uns ein freundlicher Grenzschutzbeamter, Herr Panck, zur neuen Behausung in Vennebrügge. Er „wohnte“ dort schon seit Anfang April 1946 in einer der drei zerschlagenen Wohnungen des Zollgrenzschutzbeamtenhauses und hat uns in unsere neu "Wohnung" und Vater in den Dienst eingewiesen. Die dritte Familie, es waren die Reckes, folgte eine Woche später. Der Bezirkszollkommissar aus Itterbeck ließ sich erst fast zwei Wochen später blicken und stellte viele dumme Fragen über den "Osten". Er war wohl schon im 3. Reich Zoll-Kommissar gewesen. Dass er wieder in seine alte Funktion eingesetzt wurde, wunderte einen Bauer - er meinte: "Da giv et wohl n Persülschin".
- Am 10. Juli 1947 wurde Opa durch die Leitstelle der Finanzverwaltung für die Britischen Zone als Zollbetriebsassistent zum Beamten ernannt. Die erste umfassende Einführung von Opa in den Zollgrenzschutz erfolgte danach auf einem Lehrgang vom 1.9.1947 bis zum 10.10.1947 in Flensburg, bis dahin war Herr Panck ein zuverlässiger Unterstützer.
- Am 15.12.1948 erhielt Opa vom niedersächsischen Ministerium für die Entnazifizierung vom Hauptausschuss für die Polizei in Osnabrück unter dem Aktenzeichen Au-VE 1563/48 den Einstellungsbescheid, „dass die vorgenannte Person vom Entnazifizierungsrecht nicht betroffen ist“.
Zu Vennebrügge siehe auch das Luftbild: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/NKFHCHAYKBB6VBG4ZOHMCWPWIGWUZ6CY
Zu Vennebrügge und dem dazugehörigen Zollamt siehe auch den ersten Teil des NDR Fernseh-Beitrages: NDR Retro https://www.ndr.de/geschichte/ndr_retro/nordschau806-ardplayer.html
und zur Geschichte von Vennebrügge siehe : https://www.bv-wielen.de/gemeinde-wielen/siedlungsgeschichte/
Polnische Besatzungszone
Dazu folgender Einschub zur polnischen Besatzungszone:
1945 wurden die ehemaligen Gebiete der Emslandlager – in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim - vorübergehend mit ein Teil der polnischen Besatzungszone.
Die Emslandlager waren eine, von den Nationalsozialisten eingerichtete Gruppe, von Konzentrations-, Straf- und Kriegsgefangenenlagern in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim, im Westen Niedersachsens an der holländischen Grenze. Es gab insgesamt 15 errichtete Gefangenenlager. Sie dienten den Nationalsozialisten von 1933 bis 1945 als Haftstätten mit wechselnden Funktionen mit zentraler Verwaltung in Papenburg. In den 15 Emslandlagern der Nazis mußten die Häftlinge unter KZ-Bedingungen schwerste Moorarbeiten leisten. Ein weiterer Schwerpunkt war der Bau des Seitenkanals Gleesen-Papenburg. Insgesamt wurden etwa 80.000 KZ-Häftlinge und Strafgefangene sowie 100.000 bis 180.000 Kriegsgefangene in den Lagern inhaftiert. Bis zu 30.000 Menschen, überwiegend sowjetische Kriegsgefangene, starben. Hier entstand auch ein berühmtes Lied. "Die Moorsoldaten" ist ein Lied, das 1933 von den Häftlingen des Konzentrationslagers Börger Moor bei Papenburg geschrieben wurde. Folksänger wie Hannes Wader oder Pete Seeger nahmen es in ihr Repertoire auf. Es gibt zahlreiche Jazz- und sogar Punk-Fassungen. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Moorsoldaten

Im April 1945 erreichten 13.000 Mann polnischer Truppen der antikommunistischen polnischen Exilregierung in London, gemeinsam mit britischen und kanadischen Einheiten unter der Führung des britischen Generalfeldmarschalls Bernard Montgomery, das Emsland. Die Emslandlager wurden von britischen, kanadischen und polnischen Einheiten befreit. Die befreiten Lagerinsassen wurden zunächst in neu eingerichtete Displaced Persons (DP)-Lagern untergebracht. Als Displaced Person wurde eine Zivilperson bezeichnet, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatstaates aufhielt und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder sich in einem anderen Land neu ansiedeln konnte. Zu diesem Zweck evakuierte im April 1945 die britische Militäradministration schon einige Gemeinden im Emsland und requirierte geeignete Gebäude.
Mitte Mai 1945 schlug General Henry Crerar, der Kommandant des II. Kanadischen Korps - an dessen Seite die I. Polnische Panzerdivision kämpfe - dem Oberbefehlshaber der britischen Besatzungstruppen, General Bernard Montgomery vor, im Emsland eine polnische Enklave einzurichten, da es dort vor Ort viele befreite polnische Lagerinsassen gab und um die eigenen Soldaten von der Besatzung zu entlasten. Montgomery nahm diesen Vorschlag an, woraufhin der Premierminister Großbritanniens, Winston Churchill, den Auftrag erteilte, aus Soldaten der polnischen Streitkräfte ein Besatzungskorps zu bilden.
Im Emsland wurden bis Januar 1946 15 DP-Lager für polnische Displaced Persons (DP) sowie ein Lager für Polen aus dem Baltikum aufgebaut. Die neu eingerichteten DP-Lager waren räumlich nicht identisch mit den Nazi-Lager. Sie wurden in den betroffenen Gemeinden und umliegenden Orten in öffentlichen Gebäuden, Heimen, Herbergen, Hotels und Gasthäusern als Unterbringungsgelegenheiten eingerichtet. Privat-Häuser mussten in Haren, Friesoythe, Völlen und Teilen von Papenburg zur Unterbringung der polnischen DPs ganz oder teilweise geräumt werden. Für die Soldaten wurden innerhalb der deutschen Kasernengelände zusätzliche Baracken errichtet. Die Lager wurden bis Juni 1947 durch die Hilfsorganisation United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) betreut und standen anschließend unter der Obhut der International Refugee Organization (IRO). 1951 ging die Verantwortung der DP-Lager an eine deutsche Verwaltung über. Die verbliebenen DPs erhielten den Rechtsstatus Heimatlose Ausländer. Das letzte DP-Lager wurde in Lingen erst 1957 aufgelöst.
Die dann eingerichtete polnische Besatzungszone war von 1945 bis 1948 ein Sondergebiet innerhalb der britischen Besatzungszone im Nachkriegsdeutschland. Sie befand sich vom 3. Juni 1945 bis zu ihrer Auflösung am 10. September 1948 im heutigen Bundesland Niedersachsen in den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Emsland und Cloppenburg sowie mit den heutigen Samtgemeinden Fürstenau, Artland, Bersenbrück, Neuenkirchen und der Gemeinde Bramsche im Landkreis Osnabrück. Am 20. Mai 1946 wurde die polnische Besatzungszone um den Landkreis Leer und am 3. August 1946 um Emden sowie den Landkreis Aurich, die heutige Samtgemeinde Holtriem und die westlichen Ortschaften der Samtgemeinde Esens im Landkreises Wittmund erweitert. Die Besatzungszone grenzte an die Niederlande und umfasste ein Gebiet von 6470 km².
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Polnische_Besatzungszone

Nach der Kapitulation Deutschlands am 5. Mai 1945 befanden sich rund 250.000 Polen, Soldaten, ehemalige Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Lagerinsassen in der gesamten britischen Besatzungszone. Einige suchten die Nähe der polnischen Division im Emsland, von der sie sich Schutz und Hilfe versprachen. Allerdings gab es nur Mund zu Mund Informationen. Trotzdem kamen bald rund 30.000 ehemalige polnische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Lagerinsassen und rund 13.000 polnische Soldaten im Emsland zusammen und bildeten die polnische Enklave.
Die Zone wurde von der polnischen Exilregierung in London verwaltet. Verwaltungszentrum dieser polnischen Zone wurde die Stadt Haren zwischen Meppen und Papenburg, in Höhe der ehemaligen Lager Oberlagen (VI) und Wesuwe (VIII) an der Ems gelegen. Seit Mai 1945 bildete Haren für drei Jahre lang das politische und kulturelle Zentrum des polnisch verwalteten Gebiets im Emsland. Die gesamte Gemeinde Haren wurde ein polnisches DP-Lager.
Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Emslandlager#cite_note-12
Am 20. Mai 1945 erhielt auch der Bürgermeister der emsländischen Gemeinde Haren den Räumungsbefehl. Zwischen dem 21. und 28. Mai mussten 514 Häuser geräumt werden. Nur der Bürgermeister mit seiner Familie, der sich um die Aufrechterhaltung der deutschen Verwaltung und die in umliegenden Dörfern untergebrachten Exil-Harener kümmerte, und die Ordensschwestern im St.-Franziskus-Krankenhaus durften in Haren bleiben. Etwa 1.000 Familien wurden in den umliegenden Bauerhöfen zwangseinquartiert.
In die Gemeinde Haren zogen rund 4000 polnische Bürger ein. Die Gemeinde bekam einen polnischen Bürgermeister und Gemeinderat, polnische Straßennamen, Schulen, ein Kino sowie zwei Theater und wurde Sitz des polnischen Lehrerverbandes, der von hier aus das Schulwesen in den westlichen Besatzungszonen organisierte. Einen neuen Namen bekam die Gemeinde auch. Kurze Zeit lautete er Lwów. Aber bei einem Truppenbesuch am 24. Juni 1945 gab ihr der polnische Oberbefehlshaber General Graf Tadeusz Bór-Komorowski in einer Feierstunde den Namen Maczków zu Ehren des scheidenden Kommandeurs der 1. Panzerdivision Stanisław Maczek.
Als Untertan der Österreichisch-Ungarischen Monarchie wurde Stanisław Maczek (* 31. März 1892 in Warschau; † 11. Dezember 1994 in Edinburgh) bald nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs in die Armee der Österreichisch-Ungarischen Monarchie eingezogen. Dort entdeckte man seine militärischen Talente, für die er zahlreiche Beförderungen und Auszeichnungen erhielt. Beim Sturz der Habsburgermonarchie am 11. November 1918 desertierte er aus der österreichisch-ungarischen Armee, trat in die polnische Armee ein und nahm an den Kämpfen um die Unabhängigkeit und die Grenzen des polnischen Staates teil.
Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1.8.1939 kämpfte er als polnischer General mit seinen Einheiten zunächst in der Gegend von Lemberg gegen die Deutsche Wehrmacht. Durch die sowjetische Besetzung Ostpolens war er jedoch nach dem 19. September 1939 gezwungen, mit seinem Verband die Grenze nach Ungarn zu überschreiten. Er begab sich sogleich weiter nach Frankreich, wo er die 10. gepanzerte Kavalleriebrigade als Teil der polnischen Streitkräfte im Westen neu zusammenstellte. Nach dem deutschen Angriff auf Frankreich im Juni 1940 kämpfte er mit diesem Verband zunächst in der Champagne. Nachdem die Verteidigung Frankreichs zusammengebrochen war, schlug er sich mit etwa 500 Mann nach Marseille durch, wo es ihm als Araber verkleidet gelang, das Mittelmeer zu überqueren und über Tunis, Marokko, Portugal und Gibraltar schließlich nach Schottland zu gelangen.
Kurz vor der Niederlage Frankreichs 1940 wurden zirka 35.000 dort kämpfende polnische Soldaten nach Großbritannien und das unter britischer Verwaltung stehende Mandatsgebiet Palästina evakuiert. Am 28. April 1940 wurde das 1. Polnische Korps in Schottland gegründet. Es bestand zunächst aus 885 Offizieren, 15.210 Unteroffizieren und Mannschaften. Die notwendige Ausrüstung kam von der britischen und amerikanischen Armee. Das Korps sollten zunächst 200 bestimmte Kilometer der schottische Küste gegen eine mögliche Invasion der Wehrmacht schützen.
Auf Befehl des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Generals Sikorski, wurde die Westarmee Polens neu aufgestellt. Im September 1941 entstand die 1. Polnische Fallschirmjägerbrigade, die 2.300 Soldaten umfasste. Am 25. Februar 1942 wurde die 1. Panzerdivision in Schottland mit 18.000 Soldaten gegründet. General Stanislaw Maczek übernahm dort das Kommando. Er war bereits ein anerkannter Stratege im Panzerkrieg.

Am 1. August 1944 kehrte Maczek mit seinem in Schottland neu aufgestellten polnischem Verband, der 1 Dywizja Pancerna (1. Panzerdivision), im Zuge der Invasion der Alliierten der Normandie mit zunächst 18.000 Mann auf den Kontinent zurück. Als Teil des 2. Kanadischen Korps nahm seine Einheit mit der Verteidigung des Mont Ormel an der Schlacht von Falaise in der Normandie teil. Die 1. Panzerdivision gelangte dann bei der Verfolgung der sich zurückziehenden Wehrmacht, über Belgien nach Holland, wo ihr die Befreiung der Stadt Breda gelang. Die 1. Polnische Panzerdivision eroberte Breda am 29. Oktober 1944 zurück. Dafür wurden alle direkt beteiligten Soldaten dieser Einheit zu Ehrenbürgern der Stadt ernannt, da es bei der Eroberung keine Verluste unter der schutzsuchenden Zivilbevölkerung gab. Sie hatte weitgehend in Gebäude zurückgezogen, die auf Befehl von Maczek von den Kampfhandlungen verschont wurden.
Im April 1945 wurde die Lager im Emsland befreit, darunter das Frauenlager in Oberlangen, wo über 1.700 Frauen aus dem Warschauer Aufstand gefangen gehalten wurden. Als Nächstes wurde Wilhelmshaven erobert. Die deutschen Einheiten ergaben sich am 6. Mai 1945. Im Hafen kapitulierten das Nordsee Kommando: zwei Admirale mit zusammen 1900 See-Offiziere, 32.000 Bootsmännern und Matrosen. Im Hafen wurden vorgefunden: Der deutsche Kreuzer Köln, 18 U-Boote und weitere 205 teils kleinere Kriegsschiffe.
Im Juni 1945 wurde Maczków zum Divisionsgeneral ernannt.
Nach der Kapitulation Deutschlands übernahm General Maczek am 20. Mai das Kommando über das 1. Polnische Korps in Schottland. General Klemens Rudnicki wurde der neue Kommandant der 1. Panzerdivision im Emsland. Die Division verkleinerte sich bis 1947 auf 8.000 Mann, der größte Teil der demobilisiert Soldaten zog nach England. Die Einheiten der 1. polnischen Panzerdivision (schwarzen Division) fungierten die nächsten zwei Jahre als Besatzer im nordwestdeutschen Raum. Zusammen mit der 1. Polnischen Fallschirmjägerbrigade (1. SBS) bildete sie das 1. Polnische Korps. Im Juni 1947 wurde die Division nach England verlegt und zusammen mit dem Polnische Korps in Schottland demobilisiert. Die Mehrheit der Soldaten kehrte nicht in das kommunistische Polen zurück, sondern blieb im Exil. Während des Krieges verlor die 1. Polnische Division insgesamt 975 Soldaten.
Da Maczek nicht bereit war, sich den neuen kommunistischen Machthabern Polens unterzuordnen, entschied er sich für das schottische Exil. Die polnische Staatsbürgerschaft wurde ihm aberkannt, und die britische Regierung verweigerte dem Kriegshelden den Kombattantenstatus sowie den einer Militärperson, so dass er lange Jahre als Barmann in Edinburgh im "Dorchester" und im "Learmonth" arbeiten musste. Die Regierung der Niederlande ernannte ihn immerhin zum Ehrenbürger. 1961 veröffentlichte er seine Erinnerungen mit dem Titel Od podwody do czołga (Vom Pferdewagen zum Panzer). Nach dem Sturz des kommunistischen Regimes erlebte Maczek noch seine Rehabilitierung, 1990 wurde er zum Waffengeneral ernannt und in seinem Todesjahr 1994 mit der höchsten polnischen Auszeichnung, dem Orden des Weißen Adlers, geehrt. Bestattet wurde Maczek auf dem Kriegsgräberfriedhof in Breda in Holland.
Displaced Persons „heimatlosen Ausländern“ wurden im Emsland u.a. im Dorf Neuvrees, ein heutiger Stadtteil der Gemeinde Friesoythe - umbenannt in Kacperkowo, kurzfristig nach 1945 angesiedelt.

Dort wurde 1945 sogar eine neue Kirche von Displaced Persons gebaut. Als Displaced Person wurde eine Zivilperson bezeichnet, die sich kriegsbedingt außerhalb ihres Heimatstaates aufhielt und ohne Hilfe nicht zurückkehren oder sich in einem anderen Land neu ansiedeln konnte.
Weitere Orte, die von der deutschen Bevölkerung geräumt werden mussten, waren Teile von Papenburg und Friesoythe (der Ortsteil Neuvrees wurde in Kacperkowo umbenannt und weist aus dieser Zeit noch heute eine so genannte „Polenkirche“ auf).
Das Straßendorf Völlen wurde nicht evakuiert. Hier erfolgte die Trennung der Bevölkerungsgruppen entlang der Straßenmitte: die deutschstämmige Einwohnerschaft wurde auf der östlichen Straßenseite konzentriert, während in die leer geräumten Häuser auf der westlichen Straßenseite Polen einzogen.
Die neue polnischstämmige Bevölkerung setzte sich zusammen aus etwa 30.000 Displaced Persons, vor allem ehemaligen Häftlingen der Emslandlager – zu diesen gehörten auch Angehörige des Warschauer Aufstandes vom August 1944 – und 13.000 polnischen Soldaten.

Da die überwiegende Zahl der Häftlinge aus den damaligen polnischen Woiwodschaften Lwów und Stanislau, dem heutigen Iwano-Frankiwsk, kamen, wurde die Stadt Haren zuerst in Lwów umbenannt. Die wichtigsten Straßen der Stadt Haren erhielten polnische Namen dieser Orte. Bereits nach einem Monat wurde auf sowjetischen Druck der Name am 24. Juni 1945 erneut geändert.
Das ursprünglich polnische Iwano-Frankiwsk gehörte nach der 1943 von Stalin beschlossenen Westverschiebung von Polen und nach der internationalen Konferenz von Jalta, ab 1945 zur UdSSR und gehört ab 1991 zur selbstständigen Ukraine. Insgesamt wurden etwa 1,7 Mio. Menschen durch die Westverschiebung in Polen zwangsumgesiedelt.
Die Stadt Haren wurde nach dem sowjetischen Einspruch nunmehr nach dem polnischen General Maczek benannt, der mit seiner polnischen 1. Panzerdivision die umliegenden Gefangenenlager im Emsland befreit hatte. Da sich ein großer Teil der in deutschen Lagern internierten polnischen Intelligenz hierauf in Maczków niederließ, entwickelte sich der Ort sehr dynamisch zum Zentrum des polnischen Verwaltungsgebietes, hinter dem die antikommunistische polnische Exilregierung stand.
Der große Geiger Yehudi Menuhin, der hier im Sommer 1945 ein Konzert gab, rühmte Haren als fröhliche, „scheinbar unbeschwert lebende Stadt“. Im Sommer 1946 gab es dort Schuster, Schneider, Uhrmacher, Fleischer und Bäcker, die auch die umliegenden polnischen Lager belieferten. Sogar eine Spielzeugwarenfabrik schuf man. Überdies gab es Theatergruppen, Kabarett und ein Kino.
Die polnische Exilregierung soll sogar darüber nachgedacht haben, die Enklave auf bis zu 200.000 Polen aufzubauen, um so indirekt Druck für freie Wahlen in Polen ausüben zu können. Die durch die polnische Exilregierung verwaltete polnische Besatzungszone im Emsland war für die Sowjetunion nicht tolerierbar, obwohl Winston Churchill diese Pläne zunächst begrüßte. Deshalb verlangte die Sowjetunion von den britischen Behörden - nach einer Wahlniederlage von Churchill bei der Unterhauswahl - die polnische Zone im Emsland aufzulösen, was auch geschah.
"Racheakte von Zwangsarbeitern gegen ihre ehemalige „Herrschaft“ waren selten. Allerdings gab es Überfälle auf Bauernhöfe, Diebstahl von Fahrrädern, illegales Abholzen von Bäumen, Raub von Hühnern oder Obst. Die daraus resultierende Spannung zwischen Deutschen und Polen führte wiederum zu Spannungen mit den Briten."
Am 10. September 1948 verließen die letzten polnischen Soldaten das Emsland, nach Polen (in den neuen Grenzen) oder in die Commonwealth-Staaten. In die von der UdSSR annektierten polnischen Gebiete konnten sie nicht zurück. Die Stadt Maczków wurde wieder der deutschen Verwaltung unterstellt und erhielt am 10. September 1948 ihren ursprünglichen Namen Haren (Ems) zurück.
Der polnischen Historiker Rydel hat als Erster die militärgeschichtlichen Quellen aufgearbeitet und den verwickelten politischen Entscheidungsprozess nachgezeichnet, der zu der Einrichtung einer polnischen Enklave im Emsland innerhalb der britischen Besatzungszone führte.
Die 1. polnische Panzerdivision der antikommunistischen polnischen Exilregierung in London war zwar in den die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim von 1945 - 1948 Besatzungsmacht im Rahmen der englischen Besatzungszone, zentrale Funktionen, wie z.B. der Grenzzoll, blieben aber in englischer Hand. Nach dem Kriege wurde das Zollamt in Vennebrügge, das direkt an der Grenze lag, zunächst als Unterkunfts- und Verwaltungsgelegenheiten von der englischen Militärbehörde genutzt. Im März 1946 übernahm der deutsche Zollgrenzschutz die Verantwortung für die Grenze und zwei deutsche Beamte zogen in das Zollamt in Vennebrügge.
Im wenige Schritte entfernt liegenden Zollbeamtenhaus in Vennebrügge sollen noch bis zum Frühjahr 1946 noch Polen einquartiert gewesen sein. Im April 1946 zogen dort drei deutsche Zollfamilien ein und wurden zur Grenzaufsichtsstelle (GASt) Vennebrügge. Ein britischer Kontrollbeamte überwachte bis zum 1. April 1949 noch den Dienst von Zollamt und Grenzaufsicht.
Der Verlust in der polnischen Besatzungszone von Möbeln und Hausrat in den besetzten Wohnhäusern, so hörte man später, soll hoch gewesen sein. Zusätzlich hatten die befreiten Zwangsarbeiter und Insassen der Konzentrationslager in den ehemals noch vorhandenen reichsdeutschen Dienststellen „alle Möbel, Fenster und Türen kurz und klein geschlagen", hieß es von den einheimischen Bauern.
Die „Besatzungsschäden“, insbesondere der Verlust von Einrichtungsgegenständen in den dort besetzten Häusern, beliefen sich auf etwa 8,5 Millionen Mark.
Unsere Wohnung hatte drei Zimmer, einen Stall und ein Plumpskloo
- Hildegard Kiehl berichtete weiter:
- Wir fingen im Zollbeamtenhaus in Vennebrügge an mit einem selbst gestopften Strohsack, einem Tisch aus alten Dielenbrettern, mit zwei Stühlen ohne Sitze, einer kleinen Hängelampe mit Petroleum. Keinen Herd, nur mit einem geliehenem Kanonenofen und einem Kochgeschirr wurde gekocht! Das war der Anfang unsers neuen gemeinsamen Lebens in unserer neuen Wohnung in Vennebrügge.
- Die Wohnung hatte drei Zimmer, eine geräumige Küche und Stallungen für Schwein und Hühner und ein Plumpsklo! Ein Garten für Gemüse gehörte auch dazu. Aber keine Türen, keine Fensterscheiben, kein Strom, kein Wasser, weder Herd noch Ofen, natürlich hatten wir auch keine Möbel! Aber zwei frischgestopfte Strohsäcke lagen für uns bereit. Euer Opa hatte zwei Decken und seinen dicken Wehrmachtsmantel aus dem Krieg mitgebracht. Dazu noch zwei Paar Knobelbecher, meine waren in der kleinen Größe noch zu groß — aber ich haben sie in der kalten Jahreszeit ausgestopft mit Socken tapfer getragen.
- In Vennebrügge kam aber bald alles wieder zurecht, Türen und Fenster zuallererst. Zwei eiserne Bettgestelle ohne Latten (da kamen einfach Dielenbretter aus dem alten Zollhaus hinein!), dann zwei neue Stühle, auch ohne Sitze, ein Herd und ein eigener Kanonenofen ohne Rohre! Im nahen Wald lagen genug leere Konservenbüchsen, das wurden die Ofenrohre; die wahnsinnig räucherten! Machte nichts, wir waren glücklich in unserer Wohnung!

- Euer Opa hat dann aus Dielenbrettern einen Tisch und ein kleines Regal gezimmert. Strom hatten wir immer noch nicht. Aber wir bekamen eine kleine Petroleum-Wandlampe von einer lieben einheimischen Oma geschenkt. Die Lampe war unser kostbarstes Stück, ohne Zylinder! Zwei große leere Benzinkanister aus dem Wald hat Euer Opa zu Wasserbehältern umgebaut, das Wasser mussten wir von den Bauern schleppen! Auch Waschbehälter entstanden daraus. Die alte Pumpe war geklaut worden, die neue kam erst Ende 1946.
- Die Tage vergingen sehr schnell; denn wir hatten immer eine Beschäftigung. Ich half den Bauern viel auf den Feldern, gegen Naturalien. Wenn Euer Opa Zeit hatte, gingen wir gemeinsam hin, pro Tag gab es für beide 1 Zentner Kartoffeln, auch in der Getreideernte waren wir dabei.
- Essen gaben uns die Bauern obendrein, leckere Bratkartoffeln und Milchsuppe zum Abend; am Nachmittag dicke Wurstschnitten und Kaffee - alles satt! Wir konnten ein Schwein versorgen, auch Hühner, sechs an der Zahl und einen Hahn.
- Dieser war zu unsere Nachbarin Frau Recke mit ihren leuchtenden roten Haaren sehr böse! Sie durfte sich nicht in seiner Nähe blicken lassen, schon saß er ihr auf dem Rücken und teilte heftige Schnabelhiebe aus; darum wanderte er in den Kochtopf. Die Familie Recke hatte eine ältere Tochter, die, wenn Not am Manne war, auch auf das Haus aufpasste wenn alle Erwachsenen unterwegs waren. Es waren viele "Fremde" auf der Straße unterwegs.
- Der dritte Nachbar war die Familie Panck. Sie besaß ein altes DKW-Motorrad – Benzin war aber schwierig zu besorgen. Gute Beziehungen zur Besatzungsmacht halfen dabei. Herr Panck war vor dem Nationalsozialismus Englischlehrer gewesen. Er war auch als Fußball-Schiedsrichter im Landkreis unterwegs. Die Familie Panck hatte zwei fußballbegeisterte Söhne.
- Wasser lieferte ein neue Handpumpe, die hinter dem Haus draußen aufgebaut wurde, die alte Pumpe war ja verschwunden. Die neue Pumpe wurde im Winter sehr sorgfältig mit Stroh verpackt. Alle Vierteljahr kam Bauer Schulding mit einem bespannten Kesselwagen um die Sickergruben des Zollhauses auszuschöpfen, es dauerte immer fast den halben Tag. Bauer Schulding merke immer an, daß Zeitungspapier als Klopapier nicht geeignet ist.
- Einmal im Sommer hatte sich der auf der Weide angepflockte Zuchtbulle von Bauer Kampherbeek losgerissen, und lag auf dem warmen Asphalt direkt vor dem Haus. Es dauerte fast vier Stunden, bis er vom benachrichtigten Bauern abgeholt wurde. Während dieser Zeit traute sich niemand aus dem Haus.
- Vennebrügge war eine Dorfgemeinschaft. Wenn es eine Familienfeier bei den Deutsch-Holländern gab, gehörten auch wir Zöllner dazu. Es wurde ein „Söpken" (klarer Schnaps) ausgeschenkt. Der Bauer oder sein Sohn ging mit der vollen Schnapsflasche und nur einem Schnapsglas von einem zum anderen. Bei großen Feiern wurde mehr als ein Glas ausgeschenkt und es gab ein großes Essen. Die Feiern fanden dann auf der Hofdiele statt. Es wurden klappbare Biergartentische und Bänke beim Gasthaus Heideschlösschen ausgeliehen. Es kamen bis zu 40 Gäste zusammen. Die fünf Zollfamilien bildeten eine eigene Bankreihe. Im Winter schnaubten die angebundenen Kühe im Rücken .
- Das Emsland hatte seine Besonderheiten.
Emsland
Einschub:
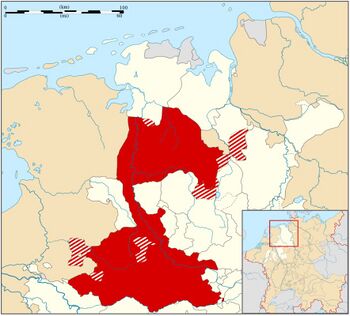

Im späteren Mittelalter und der frühen Neuzeit wurden die katholischen Bischöfe in Münster zu Landesherren eines Territoriums, dass größtenteils zwischen den Flüssen Ems und der Hunte, einem westlichen Nebenfluss der Weser, lag.
Die Grafschaft Bentheim war im Besitz der Fürsten von Bentheim und Steinfurt. Das Haus Bentheim-Steinfurt war seit 1544/1564 bis 1575 evangelisch-lutherischen Glaubens, wechselte dann aber zum evangelisch-reformierten Glauben. Im Laufe der jüngeren Geschichte hat sich die Zugehörigkeit der Grafschaft Bentheim oft verändert. Zunächst wurde die freie Reichsgrafschaft 1753 unter Graf Friedrich Karl an den König von Großbritannien und Kurfürsten von Braunschweig und Lüneburg auf dreißig Jahre verpfändet. Am 5. Mai 1804 schloss Graf Ludwig zu Bentheim und Steinfurt mit Kaiser Napoleon I. den sogenannten Pariser Vertrag. Damit wurde der Graf wieder in die Regierung der Grafschaft Bentheim eingesetzt. Er zahlte eine Ablösesumme von 800.000 Francs und übernahm die Verfügungsgewalt über das Kloster Frenswegen. Nach der Niederlage Napoleons fiel die Grafschaft Bentheim dann im Rahmen des Wiener Kongresses 1815 dem Königreich Hannover zu. Im Rahmen dessen wurde das zu dieser Zeit in der Grafschaft noch verwendete holländische Geld durch die gemeinsame hannoversche Währung ersetzt.
Die Allgemeine Encyclopädie ( https://www.his-data.de/allenc/s1/0/9/ben/ae-1-09-044,bentheim.htm S. 45 Sp. 1) berichtet:
"An Einwohnern hatte das Land (Bentheim) 1812 24.364 in 3 Städten, 1 Marktflecken, 62 Bauerschaften und 3.798 Häusern. Die westphälische Mundart ist gemein, doch findet man auch schon holländische Sprache und noch mehr holländische Sitten. Die Reformirten besitzen 14, die Katholiken 5 Kirchspiele, beide mit gleichem Rechte. 1788 waren außer 5 Edelhöfen (herrschaftliche Gutsbetriebe) 10.562, und 12.247 schutzpflichtige Unterthanen vorhanden. (Vor der „Bauernbefreiung“ des frühen 19. Jahrhunderts stand jeder schutzpflichtige Dorfbauer rechtlich als Untertan unter dem Feudalherren. Bei diesem handelte es sich gewöhnlich um einen landbesitzenden Adligen, dem der ländliche Zuständigkeitsbereich von einem oder mehreren Dörfern anvertraut worden war.) Das Land hatte sonst Provinzialstände, wozu der Prinz von Oranien wegen seiner Bentheimschen Güter, 5 Edelhöfe, 2 Klöster und 3 Städte gehörten, aber diese cessiren (weggefallen) jetzt, und Bentheim sendet zum hanöverschen Landtage 2 Deputirte, 1 von der Ritterschaft, 1 von den Städten."
Mit der preußischen Kreisreform 1885 wurde der neue Landkreis Grafschaft Bentheim im Regierungsbezirk Osnabrück gegründet, der aus den beiden vorherigen Ämtern Bentheim und Neuenhaus hervorgegangen war.
Weitere Quellen:
https://wiki.genealogy.net/F%C3%BCrstbistum_M%C3%BCnster
https://de.wikipedia.org/wiki/Bentheim-Steinfurt
https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Bentheim
Die Bischöfe waren die Herrscher über das Hoch- und Nieder-Stift Münster. Aufgrund der kirchlichen Hoheit wurden kaum neue Rittergüter im Stiftsgebiet verliehen. Die vorhandenen Güter waren überwiegend im kirchlichen Besitz und wurden 1803 zu Staats-Domänen. Bei den wenigen vorhandenen „Rittergütern“ handelte es sich zumeist um einen (ehemaligen) Besitz des Landadels, der im Feudalsystem des Mittelalters und der Neuzeit zum Landstand gehörte. Die Geschichte dieser spezifischen Adelssitze geht teils bis auf das 10. Jahrhundert zurück.
Da die rechtliche Privilegierung des Grundbesitzes auf dem Lehnssystem beruhte, veränderten sich die Verhältnisse der Ritterschaft nach der Französischen Revolution und dem anschließenden Einzug der napoleonischen Armee, so dass die Feudalrechte aufgehoben und die öffentlich-rechtliche Bedeutung der Rittergüter verlorenging. Durch das Allodifikationsgesetz von 1836 wurden die Rittersitze zum Eigengut bzw. in das Privateigentum des Inhabers umgewandelt. Über die bereits bestehenden Rittergüter hinaus konnten nun auch neue Landgüter ohne bisherigen Matrikel-Listeneintrag in die Lehnkammer oder erbrechtlichen Hintergrund erworben werden. Zunächst wurden die Ritterschaften in die Monarchien nach dem Wiener Kongress 1814/15 und in das zweite Deutsche Kaiserreich 1871 integriert, bevor sie 1918 endgültig ihre verfassungstragende Bedeutung verloren.
Der Reichsdeputationshauptschluss beendete 1803 die Existenz des bischöflichen Staates. Ein Großteil fiel als Erbfürstentum Münster an Preußen, das bereits 1802 dessen Territorium und dessen Hauptstadt Münster in Besitz genommen hatte.

Auf dem Wiener Kongress erklärte sich das von Napoleon I. aufgelöste Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg („Kurhannover“) am 12. Oktober 1814 selbst zum Königreich Hannover. Dank des Verhandlungsgeschicks des hannöverschen Kabinettministers am englischen Hof, Graf Ernst zu Münster, gelang auf dem Wiener Kongress auch eine Arrondierung des Territoriums. Dem Königreich Hannover wurden die Niedergrafschaft Lingen, das Herzogtum Arenberg-Meppen, die Grafschaft Bentheim, das Hochstift Hildesheim, die Stadt Goslar, Bereiche des Untereichsfelds und das Fürstentum Ostfriesland zugeteilt.
Seit 1814 gehörte die historische Region Emsland zum Königreich Hannover. Durch den Wiener Kongress kam das Gebiet des Oberstiftes 1815 endgültig an Preußen, das Niederstift an Hannover und Oldenburg. Von 1714 bis 1837 stand „Kurhannover“, das spätere Königreich Hannover, in einer Personalunion mit Großbritannien. Mit dem Emsland fiel das Königreich Hannover 1866 an Preußen und 1871 an das Deutsche Kaierreich, später an die Weimarer Republik und dann als Gau Weser-Ems zum 3. Reich. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das historische Emsland von 1945 - 1948 von der polnischen Exilarmee besetzt, danach Teil des Bundeslandes Niedersachsen mit den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim.

Ab dem Abzug der Polen 1948 planten die Niederlande in drei Planungsschritten, große Gebietsteile entlang der deutsch-niederländischen Grenze zu annektieren. Alle Gebiete westlich einer Linie von Wilhelmshaven über Oldenburg, Osnabrück und Münster bis Köln und Aachen sollten zu den Niederlanden kommen. Dies wurde als eine Möglichkeit der Kriegsreparation neben Geldzahlungen und dem Überlassen von Arbeitskräften in Betracht gezogen. Die Gebiete, welche nach dem Bakker-Schuts-Plan hätten annektiert werden sollen, umfassten u.a. auch das gesamte historische Emsland. Als Sympathisanten für eine Annexion hofften die Niederländer auf die vor allem in der Grafschaft Bentheim lebenden Altreformierten, die enge Verbindungen zu ihrer niederländischen Schwesterkirche pflegten und Niederländisch bis 1933 als Kirchensprache verwendeten. In den Niederlanden selbst gab es aber eine starke Opposition, insbesondere aus Kirchenkreisen, gegen die Annexionsbestrebungen.
Die Annexionen im größeren Umfang durch die Niederlande wurden von der Alliierten Hohen Kommission am 26.3.1949 mit der Begründung abgelehnt, dass Deutschland bereits mit den mehr als 14 Millionen Flüchtlingen aus den deutschen Ostgebieten überfordert sei und weitere Annexionen und Vertreibungen das Problem verschlimmern würden. Es kam nur zu kleineren Annexionen. Am 8. April 1960 schlossen die Niederlande und Westdeutschland einen Ausgleichsvertrag, der einerseits mit insgesamt 125 Millionen Mark die Opfer der deutschen Besatzung 1940 bis 1945 entschädigte, andererseits weitere Zahlungen von 155 Millionen Mark vorsah. Im Gegenzug wurden die 1949 kleineren annektierten Gebiete mit Ausnahme eines 1,25 Quadratkilometer großen, unbewohnten Waldgebietes an die Bundesrupublik zurückgegeben.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Annexionspl%C3%A4ne_nach_dem_Zweiten_Weltkrieg
Der heutige Landkreis Emsland wurde durch die Kreisreform am 1. August 1977 aus den Landkreisen Aschendorf-Hümmling, Meppen und Teilen des Landkreises Lingen gebildet. Vorher hießen diese Landkreises noch Emsland-Nord, Emsland-Mitte und Emsland-Süd. Der heutige Landkreis Emsland liegt im Westen Niedersachsens. Er umfasst große Teile der ehemaligen kulturellen und historischen Region Emsland. Der Kreis Wielen mit der Ortschaft Vennebrügge gehörte ebenfalls zur historischen Region Emsland. Er gehört jetzt zur Landkreis Grafschaft Bentheim.
Quelle Werner Franke (Hg.): Der Landkreis Emsland, Geographie, Geschichte, Gegenwart
Mit dem siegreichen Verlaufe des niederländischen Freiheitskrieges setzte dort am Ende des 16. Jahrhunderts ein gewaltiges Aufblühen zunächst des Handels und der Schifffahrt, dann auch der Gewerbe ein. Das Goldene Zeitalter (niederländisch de Gouden Eeuw) bezeichnet in der Geschichte der Niederlande eine rund einhundert Jahre andauernde wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit, die ungefähr das 17. Jahrhundert ausfüllt. Es wurden in den Niederlanden die Arbeitskräfte auf dem Lande knapp, da die Landbewohner scharenweise in die Städte strömte, um an dem dortigen Wohlstand teilzuhaben. Die deutsche Landbevölkerung des angrenzenden Emslandes suchte neben der Heimarbeit auch durch den Hollandgang ihre Lebenssituation auf ihren kargen Heuerstellen zu verbessern.
Das Emsland waren durch das Heuerlingswesen besiedelt worden und galt als arm. Das lag vor allem daran, dass rund 80 Prozent der Flächen Ödland war, hauptsächlich Heide und Moor. Die Hauptanbauprodukte Roggen und Buchweizen brachten aufgrund der schlechten Bodenqualität nur geringe Erträge. Daher waren große Teile der Bevölkerung auf Zuverdienst wie den Hollandgang oder die Leinherstellung angewiesen. 1789 gab es etwa im Kirchspiel Nordhorn 231 Heuerlingsstellen und im Kirchspiel Schüttorf 134.
Das Heuerlingswesen breitete sich in Westfalen und in Nordwestdeutschland seit dem Ende des 16. Jahrhunderts und vor allem in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus. Auf Hofstellen, die infolge des Dreißigjährigen Krieges wüst geworden waren, wurde – zunächst in leerstehenden Scheunen, Backhäusern und anderen Nebengebäuden - Familien „angesetzt“: die Heuerlinge. Die Heurigen waren im Emsland weder vollwertige Bauern oder auf dem Hof lebende Knechte, sondern verarmte ländliche Mieter. Sie besaßen kein Stimmrecht, brauchten keine Kirchenbeiträge zu bezahlen, mussten aber für das Totengeläut eine Gebühr entrichten. Die freien Heuerstellen wurden durch Ausrufer verkündet, da der überwiegende Teil der ländlichen Bevölkerung weder schreiben noch lesen konnte. Familien mit vielen älteren Kindern wurden bevorzugt, da sie zusätzlich kostenlose Arbeitskräfte mitbrachten. Die Übernahme einer solchen Heuerstelle geschah per Handschlag. Diese Verträge waren z. T. jährlich kündbar war.
Es war für ledige Mägde und Knechte, aber auch für nicht erbberechtigte Bauernkinder oft die einzige Gelegenheit, durch die erzwungene Kombination von Erträgen aus der Landwirtschaft, aus zusätzlicher Saisonarbeit („Hollandgänger“) und weiterem häuslichen Nebengewerbe (Leinenproduktion, Verarbeitung von Schafwolle, ländliches Handwerk) eine eigene Existenz aufzubauen und eine Familie gründen zu können. Etwa die Hälfte der Landbevölkerung im Emsland bestand bis 1945 noch aus den sogenannten Heuerleuten. Im Emsland besaßen die mittleren Bauern durchschnittlich 3 - 5 Heuerstellen, die großen Güter entsprechend mehr. Sie unterschieden sich aber von den ehemaligen Schatullbauern im Osten, die durch die Gutsherrschaft rechtlich noch schlechter gestellt war.
Zur Abgeltung ihres Wohnrechtes in den häufig maroden Katen und der Nutzung ihrer kleinen, vom Bauern gepachteten Ackerflächen - etwa 2 - 4 ha, waren die Heuerleute auf Abruf, verpflichtet, „ihrem Bauern“ auf seinem Hof Hand- und Spanndienste zu leisten, insbesondere in der Erntezeit. Die Zahl der Arbeitstage der Heurigen, etwa 100 – 200 im Jahre, wurde aber durch die Bauern individuell bemessen. Das zeitliche Abrufen dieser Dienste erfolgten teilweise auch willkürlich, da es keine rechtlichen Schranken gab. Die Heuerleute wurden für ihre zusätzliche Arbeit in der Erntezeit nur teilweise gegen Geld, überwiegend aber durch Naturalien „bezahlt“. Auch Frauen und ältere Kinder waren zur Mitarbeit verpflichtet. Die eigene kleine Landwirtschaft reichte fast nie aus, um Futter für das Vieh der kinderreichen Heuerlingsfamilien - mit durchschnittlich 5 Kinder - ohne Zukauf zu sichern. Für viele Heuerleute und deren Kinder war es ein Leben am Rande der Existenz.
Während des Aufkommens der Industrialisierung wanderten ein Teil von ihnen in die entstehenden Industriegebiete in Deutschland oder ins Ausland, hauptsächlich in die USA ab. Holland wurde zum Zielland für Heiratswillig beiderlei Geschlechts. Der größere Teil ernährte sich zu Hause kärglich, zusätzliche mit durch den Hollandgang oder der Heimarbeit. Während der Weimarer Republik organisierten sich Teile der Heuerleute auch politisch, um auf ihr Elend aufmerksam zu machen, was aber später von den Nationalsozialisten verboten wurde.
Quellen: Hans Lensing Heuerleute – Betrachtungen und Forschungen zum Heuerlingswesen
Helmut Lensing berichtet von den Anfänge der Textilindustrie im Bentheimer Land:
1789 gab es so etwa im Kirchspiel Nordhorn 231 Heuerlingsstellen und im Kirchspiel Schüttorf 134. Um 1800 lebten in der Grafschaft Bentheim knapp 23.000 Menschen, gegen 1840 waren es ungefähr 30.000, um 1900 waren es 36.000. Damit gehörte das Bentheimer Land zu denen am dünnbesiedelsten Gebieten Deutschlands.
Ein wichtiger Nebenverdienst der Heuerleute und der Kleinbauern war neben dem Hollandgang die sehr arbeitsintensive Herstellung von Leinen aus Flachs und teilweise auch aus Hanf. Flachs gedieh auch in der Grafschaft, vor allem in der Obergrafschaft und der nördlichen Niedergrafschaft. Leinen war als Bekleidungsstoff und auch als Segeltuch im In- und Ausland gefragt.
Während die Heuerleute und Kleinbauern Leinen in Heimarbeit herstellten – schon lange Jahrzehnte zuvor hauptsächlich für den Eigen- oder lokalen Bedarf –, verkauften zunehmend Wanderhändler wie die „Tödden“ aus dem südlichen Emsland und dem Münsterland den Überschuss an hergestelltem Leinen in die Niederlande und in andere Staaten.
Einigen Wanderhändlern gelang es, in den jeweiligen Orten ansässig zu werden und in die Kaufmannschaft aufzusteigen. Die Entwicklung verlief somit vom ambulanten zum stationären Handel. Aus Töddengemeinschaften haben sich noch heute bekannte, große Handelshäuser wie C&A Brenninkmeijer (Brenninkmeyer), Hettlage, Boecker, Peek & Cloppenburg (P&C) oder Vroom & Dreesmann (V&D) entwickelt.
Um 1825 gab es in der Grafschaft 829 haupt- und nebenberufliche Leinenweber. Das fertige Leinen wurde zum einen in die Niederlande geschmuggelt, da die Zollgrenze nach dem Wiener Kongress durch das Königreich Hannover wieder stärker kontrolliert wurde, zum anderen gab es Leinenkaufleute, die den Hauswebern ihre Produkte abnahm und für einen Weiterverkauf sorgten. Beispielsweise zählten die Behörden 1808 in Schüttorf fünf Leinenhändler, in Ohne drei, in Bentheim zwei, in Gildehaus drei, in Nordhorn drei (und noch 14 Garnhändler) und in Neuenhaus 16 Leinenhändler.
Es bildete sich in der Region mit dem Aufschwung des Leinenhandels das Verlagssystem heraus. Das bedeutete, dass ein Textilkaufmann den armen Heuerleuten und Kleinbauern den Rohstoff vorstreckte, manchmal auch den Webstuhl zur Verfügung stellte. Dafür war er einziger Abnehmer der fertigen Leinen. Dafür zahlte er dann einen vorher vereinbarten Lohn je nach Menge und Qualität. Die Weber erhielten in der Regel nicht Bargeld, sondern den Lohn in Form von Lebensmitteln oder anderen Naturalien ausgezahlt.
Damit waren die Weber stark vom jeweiligen Verleger abhängig und waren in Notzeiten vielfach bei ihm verschuldet. Die ganze Familie der Weber waren in den Arbeitsprozess eingebunden. Viele Familienmitglieder arbeiteten mehrere Arbeitsschritte des Herstellungsprozesses, so dass die Flachsbearbeitung und Leinenherstellung je nach dem Arbeitsanfall auf dem Kleinbauern- oder Heuerlingshof „nach wechselnden Nützlichkeitsgesichtspunkten oder Bedürfnissen insgesamt oder in den jeweiligen Produktionsstufen auf einzelne Familienmitglieder verteilt wurde“. Viele der Arbeitsstufen zur Flachsherstellung wurden von Kindern erledigt. So waren etwa 1832 viele Obergrafschafter Mädchen schon unter zehn Jahren mit dem Spinnen von Garnen beschäftigt, wobei besonders in der arbeitsfreieren Winterzeit auch die Frauen damit stark eingespannt waren. Die Garne wurden dann zu Leinen gewoben. Bald wurde der ursprünglich weiße Leinenstoff auch gefärbt, so dass im Bentheimer Land auch einige Färbereien entstanden.
Schüttorf bildete das Zentrum der Grafschafter Leinenproduktion. 1833 standen hier 70 der 836 Grafschafter Leinenwebstühle. Da hier überwiegend hauptberuflich produziert wurde, war ihre Jahresleistung mit 75.000 Ellen sehr hoch, verglichen mit den 173.980 Ellen, die alle Webstühle in der Niedergrafschafter außerhalb von Neuenhaus hauptsächlich nebenberuflich produzierten. In den Ämtern Neuenhaus und Bentheim gab es 1850 etwa 697 hauptbeschäftigte und 471 nebenerwerbliche Leinenwebstühle in der Grafschaft Bentheim.
Die Verlegerfamilien in der Obergrafschaft entstammten den Kaufmanns- und Ratsfamilien der Städte, so in Schüttorf etwa den Familien Rost, te Gempt oder ten Wolde. In Nordhorn und der nördlichen Grafschaft lag der Verlagshandel hauptsächlich in den Händen eingewanderter niederländischer Mennoniten, da die Niederländer die größten Abnehmer der Grafschafter Leinen waren. Weil die Grafschaft ein „Niedriglohnland“ war, waren die Gewinnspannen für die Händler in normalen Zeiten hoch. So tauchen die Namen etlicher dieser Verlegerfamilie später als die Gründer von Textilfabriken in Nordhorn auf, als sich in der Bekleidungsindustrie ein Übergang von Leinen zu Baumwolle anbahnte, was ganz andere Produktionsmethoden zur Folge hatte.
Als 1830 sich Belgien von den Niederlanden trennte und damit zunächst die flämische Konkurrenz vom niederländischen Markt verschwand, führte dies zur Einfuhr von preiswerten Baumwoll-Stoffen aus britischer Produktion in die Niederlande und ließ dort die Textil-Preise fallen. Insgesamt verschlechterten sich die wirtschaftlichen Bedingungen in den Niederlanden im 19. Jahrhundert. Die Folge war, dass die dortigen Arbeitslöhne die hiesigen nicht mehr in dem bisherigen Maße überstiegen und die einheimischen Arbeitskräfte Hollands die auswärtigen allmählich zurückdrängten.
Dies führte zugleich aufgrund der regional niedrigen Löhne auch durch den Hollandgang und den Töddengemeinschaften zu einem Einstehen einer niederländischen Textilproduktion in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grafschaft. Solange aber Baumwolle noch schwer zu beschaffen und zu bearbeiten war, war die Leinenherstellung und der Leinenhandel aber weiterhin in der Grafschaft von Bedeutung.
Infolge der sinkenden Erlöse ging zwar die Zahl der Berufweber stark zurück, vielen diente die Leinenweberei aber weiterhin als Zuverdienstmöglichkeit. In Schüttorf hatte die Bedeutung der Berufsweberei besonders stark abgenommen. Der aus Flachs hergestellter Leinenstoff wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts als Bekleidungsstoff weitgehend von der Baumwolle verdrängt. Leinen blieb als ein Nischenprodukt etwa für Tischdecken weiterhin gefragt, so dass bis ins 20. Jahrhundert der Flachsanbau im Bentheimer Land erhalten blieb.
Quellen: Butke, Irma, Zur Entwicklung der Textilindustrie in der Grafschaft Bentheim (Das Bentheimer Land, Bd. 14), Nordhorn 1939.
Schwabe, Udo, Textilindustrie in der Grafschaft Bentheim 1800-1914 (Emsland/Bentheim. Beiträge zur Geschichte, Bd. 20). Hrsg. von der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, Sögel 2008.
Von 1957 - 1958 wohnte die Familie Kiehl in Nordhorn an der Grenze auf der Blanke, bevor sie nach Hamburg umzogen. Nordhorn ist die Kreisstadt des Landkreises Grafschaft Bentheim im äußersten Südwesten Niedersachsens an der Vechte. Nordhorn nahm im Mittelalter eine Schlüsselstellung an der Flämischen Straße ein. Waren und Güter aus Skandinavien und den Hansestädten fanden ihren Weg durch Nordhorn in die Handelszentren des Westens bis nach Paris. Seit dem 19. Jahrhundert war Nordhorn eine der größten Städte der Textilindustrie in Deutschland. 1839 gilt als Gründungsjahr der Nordhorner Textilindustrie. In Nordhorn, an der historischen Friesen-Handelsstraße von Bremen und Emden über Leer, Lingen nach Münster und mit der Verzweigung nach Denventer, Groningen und Brügge gelegen, entstand die erste mechanische Schnellweberei durch Willem Stroink aus Enschede. Hier wurde Baumwolle verarbeitet, Kattun und Watertwist gewebt. Weitere Betriebe gründeten 1864 Jan van Delden und 1851 Josef Povel und Hermann Kistemaker.
Mit der Aufnahme der Massenproduktion von Schürzenstoffen, den „Nordhorner Waterschürzen“, begann 1889 der Aufstieg Nordhorns mit seinen damals 3000 Einwohnern zu einem der bedeutendsten Zentren der deutschen Textilindustrie. Die Stadt entwickelte sich u.a. durch den Emslandplan nach 1950 zu einem der größten Textilzentren Deutschlands. Die Produktion in den großen Textilfabriken Povel, Nino und Rawe in Nordhorn florierte. 1956 sollen dort mehr als 11.500 Menschen in den drei Textilfirmen gearbeitet haben, darunter auch viele Holländer, die mit Bussen an- und abtransportiert wurden. In der Stadt wohnten damals 48.000 Bewohner. Die Textilindustrie wurde über einen Zeitraum von rund 150 Jahren zum Schrittmacher für die Wirtschaft. Mitte 1980 mußten aufgrund dauerhafter billiger Textilimporte aus dem Fernen Osten alle drei Textilfirmen in Nordhorn Konkurs anmelden. 2022 wohnten 55.724 Einwohner in der Stadt Nordhorn.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Nordhorn
Auch in anderen Orten der Grafschaft, wie in Uelsen und in Schüttorf, erfuhr die Textilindustrie zunächst ein starkes Wachstum.
Es ist heute weitgehend vergessen, daß in Uelsen und Umgebung um 1920 die höchste Anzahl an Heim-Webstühlen der gesamten Niedergrafschaft gestanden haben. Sogar eine Webschule hat es gegeben. Der Leinen-Absatz nach Holland stockte aber aufgrund der verschlechterten wirtschaftlichen Situation in den Niederlanden ab 1830. Ab 1866 wurden durch die Übernahme des Königreiches Hannover durch Preußen auch die Zollgrenzen mit den Niederlanden nochmals stärker bewacht. Von da an sank die Einwohnerzahl in der Gemeinde Uelsen von 1200 auf 806. Heuerleutefamilien zogen nach Nordhorn und Schüttorf, um in der Textilindustrie Beschäftigung zu finden. Einige Familien wanderten auch in die deutschen Industriegebiete oder nach Holland und Amerika aus.
Die entscheidende Rolle bei der Industrialisierung in Schüttorfs spielte auch die Textilindustrie. Dies liegt zum einen daran, dass die Herstellung von Textilien aus Leinen auf Handwebstühlen hier schon seit Jahrhunderten betrieben wurde und zum anderen daran, dass die bäuerlichen Kleinbetriebe auf diesen Zuverdienst angewiesen waren. Im 17. Jahrhundert waren viele Schüttorfer jedes Jahr in die reicheren Niederlande gegangen, um durch Torfstechen, Mähen oder den Verkauf von Waren ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Mit der Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse in den Niederlanden ab 1830 schwand diese Einkommensquelle aber.
Einen Ausweg bot die Intensivierung der Heimweberei für den deutschen Markt. Um 1850 beschäftigte die Familie Schlikker bereits 400 Handweber, einige Jahre später wurde das erste Fabrikgebäude errichtet. 1865 folgte eine Färberei der Familie Schümer. 1867 ging die erste mechanisch betriebene Baumwollweberei von Schlikker und Söhne in Betrieb, 1881 eine Baumwollspinnerei. Schüttorfs Einwohnerzahl wuchs in der Zeit der Industrialisierung stark an: Von 1.692 Einwohnern im Jahr 1871 auf 4.110 in 1900. Der Erste Weltkrieg führte zu einem Stillstand der Textilindustrie in Schüttdorf, die sich inzwischen zum wichtigsten Wirtschaftszweig der Stadt entwickelt hatte, da keine Rohstoffe mehr geliefert wurden. Nur ein Betrieb konnte durch die Produktion von kriegswichtigen Uniformen der Schließung entgehen. Dies führte zu einer extrem hohen Arbeitslosigkeit in Schüttdorf und Umgebung. Die Gemeinde beschloss aus diesem Grund auf eigene Kosten die Urbarmachung der Schüttorf umgebenden Heide, um den Menschen so eine Perspektive zu geben. Dies führte allerdings zu einer starken Belastung der Stadtkasse. Durch die hohe Inflation war Schüttorf gezwungen, Notgeld und Brotmarken herauszugeben. Im Jahr 2000 existieren nur noch die Firmen ROFA Bekleidungswerk GmbH & Co. KG und Schümer Textil GmbH, die sich auf Arbeitskleidung und Gewebe spezialisiert haben. 2022 wohnten 5.830 Einwohner in Samtgemeine Uelsen und 13.361 Einwohner in der Samtgemeinde Schüttdorf.
Quellen:
http://www.uelsen-und-umgebung.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCttorf
Über Jahrhunderte prägt eine Sumpflandschaft das historische Emsland - das "Armenhaus der Republik". „Den Ersten sien Doad, den Tweten sien Not, den Dridden sien Broad“. Typisch für die Region waren ausgedehnte, oft unzugängliche, tief gelegene Hochmoore wie das Bourtanger Moor (heute Naturschutzgebiet) und Heidelandschaften - mit der größten Ausdehnung rund um Papenburg. Das Emsland war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs geprägt von Ödnis. Das Torfstechen in den Mooren und die Hollandgänger gehörte zur Lebensgrundlage.
1620 begann mit dem Anlegen der Siedlung Piccardie (heute Alte Piccardie, Gemeinde Osterwald) durch Johan Picardt die Moorkolonisation in der Grafschaft Bentheim.

Ein Kanalnetz entstand zwischen 1870 und 1904 im Emsland und hat eine Gesamtlänge von 111 Kilometern. Durch systematischen Kanalbau sollten die Moore und Sümpfe im Gebiet zwischen Ems und deutsch-niederländischer Grenze entwässert werden. Außerdem bedurfte die Industrie steigender Transportkapazitäten. Bis 1874 wurden Kriegsgefangene des Deutsch-Französischen Krieges zum Bau eingesetzt. Die Kanäle hatten insgesamt 20 Schleusen und 90 Brücken und waren für Schiffe mit bis zu 200 Tonnen Tragfähigkeit geeignet. Die Bedeutung dieser Wasserstraßen als Transportweg nahm allerdings ständig ab. 1899 wurde der Dortmund-Ems-Kanal eröffnet und die emsländische und nordholländische Industrie konnte ihren Bedarf an Heizmaterial mit Kohle aus dem Ruhrgebiet decken. Die Schifffahrt auf den Kanälen ist in den Jahren 1960 bis 1965 eingestellt worden, sie dienen heute zur Entwässerung. Lediglich der Haren-Rütenbrock-Kanal blieb befahrbar und verbindet die Ems mit den niederländischen Kanälen.
Teilweise wurde das Moor auch oberflächlich entwässert und die obere Vegetationsschicht im Frühjahr abgebrannt. Die so entstehende Asche diente als Dünger für den Buchweizenanbau. Diese „Moorbrandkultur“ lieferte jedoch nur geringe Erträge – Hungersnöte waren die Folge.
Die einfache kleinbäuerliche Bevölkerung - oft auch landlose Heuerleute - lebte unter ärmlichsten Verhältnissen ursprünglich in Streusiedlungen oder am Rande von Haufendörfern. Mensch und Tier teilen sich hier in den häufig hinfälligen kleinen Heuerhäusern eine bescheidene Diele. Um zu heizen und zu kochen, wurde seinerzeit der Torf in allen Bauernhäusern noch direkt auf Bodenfeuerstellen abgebrannt, die mit Feldsteinen verkleidet waren und sich an den Dielenende, dem Flett, befanden. Nachts wurde ein Eisengitter über das Herdfeuer gestülpt, um zu verhindern, dass Tiere (vor allem Katzen) sich am Feuer „ansteckten“ und dann brennend und in Panik das sich oben auf dem „Balken“ befindliche Heu und Stroh anzündeten. Die torf- oder strohgedeckten Häusern ohne Rauchabzug verqualmten und waren stark sturm- und feuergefährdet.
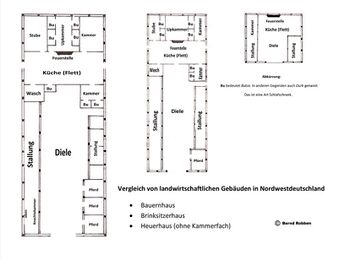
Ursprünglich gab es nur einen offenen Wohnbereiche im hinteren Bereich des Hauses zu beiden Seiten der Feuerstelle. Dort befanden sich Tische, Stühle und Schrankbetten (Alkoven), wobei ein direkter Kontakt zum eingestellten Vieh auf der Diele bestand. Die Schlaf-Gelegenheiten der einfachen Familien waren nur mit Brettern abgeteilt. Die Binnentemperaturen stiegen im Winter kaum über 14 Grad. Die bereits um 1900 in Deutschland erhältlichen gusseisernen Öfen für Familien waren für die Emsländer Kleinbauern zu teuer und die dafür notwendigen Kamine waren in ihren Katen auch nicht vorhanden. Ein gusseiserner Ofen mit Herdplatte der Firma Olsberg kostet um 1900 etwa 130 bis 150 Reichsmark – etwa die Hälfte des Jahreseinkommens eine Heuermannes im Emsland.
Es gabt nur sehr wenige Straßen, die oft stark ausgefahren waren. Noch 1932 waren 112 Ortschaften des Emslandes ohne jede Verbindung mit der Außenwelt durch eine befestigte Straße. Von den 63 Gemeinden des Kreises Meppen lagen nur 18 ganz an Straßen und nur 16 berührten wenigstens teilweise befestigte Wege. Straßen und Wege waren aber besonders für die weiblichen und männlichen Wanderarbeiter (Hollandgänger) wichtig. Bei Lingen wurde die Ems überquert. Ihr Weg führte u.a. entlang der Tüöttenroute (Textilpfad) in die Grafschaft Bentheim auch durch Uelsen und u.a. dem Grenzübertritt Vennebrügge. Die Wanderzeit lag zwischen Saat und Ernte in der Heimat, um hier keine Einbußen zu erleiden. Die vorhandenen stark wetterabhängige Feldwege waren im Winter unpassierbar. Zu den typischen Wanderarbeitern gehörten die Grasmäher (in der Grafschaft nannte man diese "Pikmäjer" ) die Torfarbeiter und die Hausmädchen. Die Hausmädchen mußten sich für mindestens ein Jahr verpflichten.
Die Zahl der Hollandgänger ist nicht genau belegt, wird aber zwischen 1700 und 1875 auf 20.000 bis 40.000 pro Jahr geschätzt und erreichte nach dem 1. Weltkrieg während der Hyperinflation ihren Höhepunkt. In der ersten Hälfte der 1920er Jahre fanden etwa 100.000 bis 300.000 deutsche Frauen als Dienstmädchen in den Niederlanden zeitweise Arbeit. 1930 arbeiteten in der Haushaltsführung noch etwa 30.000 bis 35.000 Frauen aus dem Ausland in Holland.
In den 1930er Jahren versuchten die Nationalsozialisten im Rahmen der „Hausmädchenheimschaffungsaktion“, vor allem aus bevölkerungspolitischen Gründen, die dort arbeitenden Frauen – teilweise gegen deren Widerstand – zur Rückkehr nach Deutschland zu bewegen. Behördliches Druckmittel war vor allem die Begrenzung der Gültigkeit der Reisepässe oder die Drohung mit Ausbürgerung. Nach 1933 gab es kaum noch Hollandgänger, bzw. es wurde in Holland geheiratet. Einige der männlichen ehemaligen Hollandgänger, die in Holland geheiratet hatten, wurden Mitglieder der "Vrijwilligerslegioen Nederland", der späteren Holländischen SS-Division.
In den 15 Emslandlagern der Nazis mußten die 80.00 KZ-Häftlinge sowie 100.000 bis 180.000 Kriegsgefangene schwerste Kultivierungsarbeiten in den Mooren leisten. Bis zu 30.000 Menschen, überwiegend sowjetische Kriegsgefangene, starben.
Es gab auf dem Lande im Emsland bis 1950 kaum Infrastruktur, nur sehr wenig Gewerbe und außer der Torfverarbeitung keine Industrie. Die kargen Felderträge reichten kaum zur Selbstversorgung. Oft war das zusätzliche Torfstechen oder die Saisonarbeit in Holland ein überlebensnotwendiger Nebenerwerb.
Quellen:
Bernd Robben: http://www.heuerleute.de/veroeffentlichungen-von-bernd-robben/
Kirchner-Raddestorf: http://www.kirchner-raddestorf.de/heimat/regional/ndswohn.htm
Hollandgänger: https://de.wikipedia.org/wiki/Hollandg%C3%A4nger
Hinnerk Pöttker & Bernd Botter: Die letzten 80 Jahre im Emsland
Seit dem Mittelalter wurde im Emsland in großen Mengen Torf als Heizmaterial abgebaut. Die abgetorften Flächen konnten dann landwirtschaftlich genutzt werden, aber dafür musste man den Untergrund umgraben. Bis ins 19. Jahrhundert geschah dies in Handarbeit mit dem Spaten, danach wurden auf Pflüge eingesetzt. Die Nationalsozialisten stellten ab 1933 die Kultivierung der Moore wieder auf Handarbeit mit dem Spaten durch den Reichsarbeitsdienst um, was wenig effektiv war. Das Heide Gut Wielen diente in den 30er Jahren aus Versuchsfläche für den Pflanzenanbau auf kargen Böden. Obwohl die Region damals stark verarmt war, flohen nach Kriegsende ab 1945 rund 150.000 Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten ins Emsland.



1951 wurde von der Bundesregierung zur regionalen Wirtschaftsförderung der „Emslandplan“ beschlossen. Er hatte ein Volumen von 2,1 Milliarden DM. Durch Pflügen und Kultivierung von Ödland und Moor erreichte man in einer ersten Stufe eine Vergrößerung der nutzbaren Flächen und durch verbesserte Landbaumethoden eine Steigerung der Erträge. Gleichzeitig wurde die Flurbereinigung begonnen. Das Maßnahme Bündel beinhaltete ebenfalls die Verbesserung der Wasserverhältnisse (Grund-, Ab- und Trinkwasser) und die Anlage bzw. Erneuerung weiterer Infrastruktur, Elektrizitätsversorgung und Verkehrswesen.
Insgesamt werden rund 128.000 Hektar Boden kultiviert, ein Straßennetz von 800 Kilometern ausgebaut, 6.800 Kilometer Vorfluter und Gräben ausgehoben sowie 700 Fluss-Kilometer reguliert. Gleichfalls wurden neue Dörfer angelegt oder erweitert und rund 1.250 Neusiedlerhöfe sowie etwa 5.000 Nebenerwerbsstellen entstanden. Teilweise fanden hier auch Flüchtlinge aus Ostpreußen eine neu Heimat. Den Neusiedlerhöfe wurden zinsgünstige Darlehn zum Erwerb von Traktoren zur Verfügung gestellt.
Schon vor dem 1. Weltkrieg spielte in Europa und den USA der Dampfmaschineneinsatz in der Landwirtschaft beim Pflügen eine zunehmende Rolle – war aber in der Anschaffung sehr teuer und kompliziert in der Handhabung. Er wurde erst nach dem 1. Weltkrieg durch preiswertere Benzin- und später Dieseltraktoren weitgehend abgelöst.
Siehe auch das Kapitel 6.6.4 Modernisierung der Landwirtschaft im Text Ländliche Entwicklung in Ostpreußen https://wiki.genealogy.net/L%C3%A4ndliche_Entwicklungen_in_Ostpreu%C3%9Fen,_dargestellt_am_Beispiel_von_Willschicken_(Ksp._Aulenbach_Ostp.)#cite_ref-230
1918 betrug der US-Schlepperbestand schon 85.000 Benzin-Traktoren, welche schätzungsweise die Arbeit von 250.000 Männern und 1,5 Mio. Pferden erledigten. Die USA wurden aufgrund der dort niedrigen (Benzin-) Kosten zu einem großen Getreideexporteur nach Europa. In der Regel betrugen die Betriebsgrößen der exportierenden Farmen in den USA über 10.000 ha.
Bis 1925 verwendeten in Deutschland weniger als 1 % aller Betriebe Benzin-Traktoren. Diese waren zu einem großen Teil aus den USA importiert und benötigten als Brennstoff das in Deutschland teure Benzin. Die Rentabilität eines Traktors setzte deshalb in Deutschland eine Betriebsgröße von 50 bis 70 ha voraus.
Im zweiten und dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurden leichtere Traktoren mit Verbrennungsmotor entwickelt (z. B. Deutz, Lanz oder Hanomag), die es ermöglichten, einen angehängten Pflug unmittelbar über den Acker zu ziehen.
Der Deutz Traktor F1M 414 erschien 1936 in Deutschland auf dem Markt. Er war mit seiner Leistung von 11 PS aus einem 1-Zylinder Dieselmotor der erste echte „Bauernschlepper“. Er kostete 1936 etwa 2.300 Reichsmark. Gleichzeitig gehörte er mit zu den Schleppern, die mit den neuen „Ackerluftreifen“ zum schnelleren Straßenfahren ausgeliefert wurden. Insgesamt wurden vom F1M 414 zwischen 1936 und 1951 über 20.000 Stück gebaut. Seit 1995 gehört Deutz-Fahr zum italienischen Unternehmen SDF (vormals SAME Deutz-Fahr).
Die Heinrich Lanz AG produzierte von 1921 an eine große Anzahl von Glühkopf-Traktoren, die unter dem Namen "Lanz Bulldog" bekannt wurden. Der Lanz Bulldog D7506/3, Baujahr 1936, hatte ein Leistung von 25 PS und einen Hubraum von 4,7 Liter. Er besaß eine Vielstoffmotor: es war ein ventilloser Lanz-Einzylinder-Zweitakt-Glühkopf-Mitteldruckmotor. Als geeignete Brennstoffe nannte Lanz in seinen Prospekten „Braunkohlenteer-Gasöl, mineralisches Gasöl, vegetabile und animalische Öle, Petroleum“. Er kostete 1936 etwa 3.500 Reichsmark. Insgesamt wurden zwischen 1921 bis 1957 etwa 220.000 Lanz Bulldog Traktoren gebaut. 1956 verkaufte die Deutsche Bank ihre Aktienmehrheit der Lanz AAG an das US-Unternehmen John Deere & Company.
Der Big Bud 747 ist ein landwirtschaftlicher Traktor aus den USA. Er wurde 1977 zunächst als Einzelanfertigung in Havre im US-amerikanischen Bundesstaat Montana von der Firma Big Bud Tractors Inc. gebaut und galt seinerzeit mit seiner Motorleistung von 1100 PS (820 kW) nach Aussage seiner Erbauer als „weltgrößter Traktor". Zunächst wurde er mit einer Motorleistung von 760 PS (567 kW) ausgeliefert, erhielt aber in den weiteren Jahren eine Leistungssteigerung auf 1100 PS (820 kW). Seine Besitzer zahlten damals für den Traktor 300.000 US-Dollar - nach dem Geld-Wert von 2023 etwa 1,3 Mio US-Dollar. Er konnte z. B. einen 40 Meter langen Schaaren-Pflug mit 21 Pflugschaaren oder einen 24 m breiten Grubber zu ziehen. Die Firma Big Bud Tractors Inc. hatte 25 weitere schwere Traktor-Typen im Angebot und bestand bis 1991.
Quelle:https://www.williamsbigbud.com/
Eine lokale Land-Zeitung in Niedersachsen berichtete 1980 darüber, dass ein Dorf-Bürgermeister im Emsland, dessen Sohn in Amerika lebte, angeblich Traktoren der Marke Big Bud aus den USA ins Emsland holen wollte. Er soll diese Ideen oft auch im örtlichen Dorf-Gasthaus präsentiert haben. Hintergrund war ein Streit der Gemeinde mit einer hiesigen Pflug-Betreiberfirma über die Verpflegungskosten einer Pflug-Mannschaft. Nicht nur wegen der astronomischen Preise der amerikanischen Traktoren und den hohen Einfuhrzöllen wurde aber daraus nichts. Die amerikanische Traktoren-Technik entsprach auch nicht den geltenden deutschen DIN-Vorschriften auch die heimischen Pflug-Betreiberfirmen und ihre politischen Unterstützer waren strikt dagegen.
Quelle: Hinnerk Pöttker & Bernd Botter: Die letzten 80 Jahre im Emsland
Das Pflügen von Mooren, z.B. im Emsland, wurde noch bis 1970 per Dampfkraft betrieben.
1862 gründete John Fowler in Hunslet, Leeds in England die Firma Fowler & Co., einen Hersteller u. a. von Lokomobilen und Dampfpflügen.
Ein Lokomobil war ein selbstfahrender Dampftraktor oder Dampfschlepper, der speziell für die Landwirtschaft zwischen etwa 1860 und 1930 gebaut wurde. Er diente hauptsächlich der Arbeit auf dem Feld. Ausgangspunkt der technischen Weiterentwicklung bildeten die schon zeitlich vorher vorhandene Dampfzugmaschinen, mit deren Hilfe Personen und Güter auf mehreren Anhängewagen über Straßen und Wege gezogen wurden. Zudem verfügten die Dampfschlepper über mindestens eine Riemenscheibe für den Antrieb stehender landwirtschaftlicher Geräte, wie zum Beispiel einer Dreschmaschine.
Ein Dampfpflug war ein durch Lokomobile gezogener dafür speziell entwickelter Maschinenpflug. Dampfpflüge besaßen in Europa auf Grund der häufig feuchten Böden 1 bis 6 Pflugschaaren, in den USA auf Grund der trockenen Böden sogar bis 18 Pflugschaaren. 1852 begann in England John Fowler mit Versuchen zur Nutzung der Dampfmaschine im Ackerbau. Er war u.a. ein weiterer Schritt der Mechanisierung der Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft, welche vorher nur mit tierischer bzw. menschlicher Muskelkraft auskommen mußte.
Quelle: https://dampf-selbstfahrer.de/wp-content/uploads/2019/02/Z-3.pdf
Einen Pflug direkt hinter die Dampfmaschine zu spannen, war oftmals nicht möglich, weil wegen ihres großen Gewichts die Maschine in feuchten oder moorigen Böden eingesunken wäre und zudem die Haftung der Antriebsräder meist nicht ausreichte, um die zum Tiefpflügen erforderlichen Kräfte auf den Boden zu bringen, obwohl die Eisenräder über ein bis zwei Meter breit waren. Manchmal besaßen sie auch Doppelräder. Raupenkettenfahrzeuge wurden erst ab 1905 - z. B. bei der englischen Armee im 1. Weltkrieg - eingesetzt.
Maschinensätzen bei denen Lokomobile mit langen Seilen Pflüge zogen waren eine machbare Alternative. Durch das Fowlersche Zwei-Maschinen-System wurden Pflug oder Grubber, Egge und Walze an einem Drahtseil zwischen zwei abwechselnd arbeitenden „Pfluglokomotiven“ hin und her gezogen. Das System wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA, in England und in Frankreich weiterentwickelt.
Etwa ab 1860 wurde der Dampfpflug in England, zunächst noch in kleinem Maße, eingesetzt. Hierzulande erfolgte der erste Einsatz 1863 in Blumenberg bei Wanzleben auf einer preußischen Domäne. In Deutschland fanden die kapitalintensiven Maschinensätze vermehrt ab 1875 statt, zuerst auf den sehr großen Gutsbetrieben und Rittergütern in Posen, Sachsen und Schlesien. Das Entfernen der Steine, das Ausroden von Wurzeln, das Trockenlegen und Arrondieren der Äcker waren Meliorations-Arbeiten, welche unter allen Umständen dem Dampfpflügen vorangehen mußten.
Es ging hauptsächlich um das Pflügen von großen Flächen. 15 - 20 Hektar „normalen“ Acker am Tag schaffte je nach Maschinenart ein Dampfpfluggespann. Die durchschnittlichen Arbeitskosten einschließlich Abschreibung, Zinsen, anteiligen Reparaturkosten usw. betrugen 8 bis 10 Mark je Morgen. Der wirtschaftliche Einsatz des Zweimaschinensystems setzte eine hinreichende Größe der Flächen voraus. Die untere Grenze war etwa 10 ha., damit sich ein Ein-Tages-Einsatz noch lohnte. Ein Pferdegespann konnte je nach Bodenbeschaffenheit, Pflug Typ und Pferdestärke etwa 1 bis 2 Hektar pro Tag pflügen.
Quelle: https://de.wikisource.org/wiki/MKL1888:Dampfpflug
Bekannte Hersteller von Dampfpflug-Sätzen waren u.a. die Unternehmen John Fowler & Co. in Leeds England, J. Kemna in Breslau , Borsig in Berlin/Dortmund, A. Heucke bei Quedlinburg und Ottomeyer in Pyrmont/Lügde. Kemna wurde zum führende Dampfpflug-Unternehmen auf dem europäischen Kontinent und machte auf dem Weltmarkt den dort führenden englische Firmen Konkurrenz. Einige dieser Firmen traten auch in Deutschland als Betreiberfirmen ihrer eigenen Produkte auf.
Die Anschaffungskosten für ein Dampfpflugsystem waren außerordentlich hoch. Die Kosten der deutschen Systeme lagen über den der englischen Systeme. Beispielsweise kostete 1885 in Deutschland einschließlich der Steuer und Fracht ein importiertes englisches Dampfpflugsystem der Firma Fowler mit zwei Maschinen und einem Pflug ca. 50.000 Mk. Um 1900 belief sich der Preis für ein in Deutschland produziertes ähnliches Pflugsystem der Firma Kemna auf etwa 72.000 Goldmark. Durch Einfuhrzölle versuchte das Deutsche Reich die einheimische Industrie zu schützen. Aufgrund der generellen hohen Kosten wurde die Systeme nur von wenigen Großbetrieben und Rittergütern für den Eigengebrauch angeschafft. Durch die robuste Bauweise wurden die Maschinen bis zu 30 Jahre alt und konnten so die hohen Anschaffungskosten amortisieren.
1905 waren es in Preußen von insgesamt schätzungsweise 20.000 Gütern nur 292, dafür aber hauptsächlich große Betriebe, mit über 100 ha, die im Eigengebrauch Dampfpflugsystem benutzten. Die Maschinen wurden aber auch vermietet und zwar von Genossenschaften, mit einem Anteil von 70 % oder von Betreiberfirmen, mit einem Anteil von 30 % an allen Mietmaschinen. 1899 gab es in Preußen 1.276 Lokomobile - 1907 waren es schon 2.239. Am 1. April 1905 wurden in Preußen insgesamt 407 Dampfpflugsystem betrieben. 1907 wurde der Höchststand mit 423 Maschinen erreicht und ging danach, aufgrund des Einsatzes von kostengünstigen Benzin- und Dieselmotoren, langsam zurück.
Das Gros der Maschinen - mit insgesamt 280 - wurden in den Provinzen Posen, Sachsen und Schlesien eingesetzt. In der Provinz Hannover gab es 1905 14 Dampfpflugsätze, davon 11 bei Betreiberfirmen. Ein Betreiber in der Provinz Hannover war die Firma Ottomeyer aus Pyrmont/Lügde. In der Provinz Ostpreußen gab es beispielsweise um Rastenburg u.a. mit den Gütern Wehlack und Dublienen eine Pfluggenossenschaften. 1905 gab es in der gesamten Provinz Ostpreußen 6 Pfluggenossenschaften und 3 Betreiberfirmen. Diese Maschinen stammten überwiegend von der Fa. Kemna in Breslau.
Während des 1. Weltkrieges wurden von der Reichswahr etwa 400 deutsche Lokomobile auch zum Ziehen von Geschützen und Nachschubwagen eingesetzt. Die Firma Kemna entwickelte die „Einheits-Militär Maschine Typ EM“ und vergab Lizenzen zum Nachbau an zahlreiche andere Hersteller. Die russische Besatzungsmacht in Ostpreußen versuchte während des 1. Weltkrieges ebenfalls Transporte mit den dort vorgefundenen Lokomobilen, kam aber nicht weit, da die Kohle ausging und mit dem stattdessen eingesetzt Stroh und Holz nicht die notwendige Kesseltemperatur erreicht wurde.
Quellen:
https://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=103831
Nur ein sehr kleiner Teil der große Güter hatten sich zu lokalen Pfluggenossenschaften zusammengeschlossen. Es waren hauptsächlich “modern denkende“ Gutsbesitzer. Die überwiegende Masse der allgemein konservativen Gutsbesitzer wollten mit dem "Geld vernichtenden englischen Teufelszeug" nicht zu tun haben. Die Genossenschaften mussten räumlich überschaubaren bleiben und eine bestimmte Größe aufweisen, um wirtschaftlich zu sein, durften aber auch nicht zu groß werden. Ein Hauptproblem waren dabei die Transportentfernungen. Die Maschinensätzen zogen mit 5 - 10 km pro Stunde auf den Straßen - von allen bestaunt - von Gut zu Gut. Durch die schweren Maschinen entstanden häufig Straßenschäden.
Die Betreiberfirmen warben für ihre Dienstleistungen auch überregional. Sie nutzten bei längeren Streckten für den Maschinentransport die Eisenbahn - wenn vorhanden. Dazu waren besondere Be- und Entlade-Rampen notwendig. Die letzten Kilometer wurden die Maschinen dann selbst gefahren bzw. gezogen. Dazu mußten häufig extra Wege angelegt oder befestigt und nachträglich repariert werden.
Bei der Moorkultivierung im Emsland spielte die Firma Ottomeyer aus Pyrmont/Lügde eine besondere Rolle. 1866 erhielt Ottomeyer seine Konzession für den gewerblichen Einsatz von Dampfmaschinen, importierte zunächst zwei Lokomobilen aus England und bot diese als Lohnunternehmer der Land- und Forstwirtschaft der Region zum Dreschen und Holzsägen an.
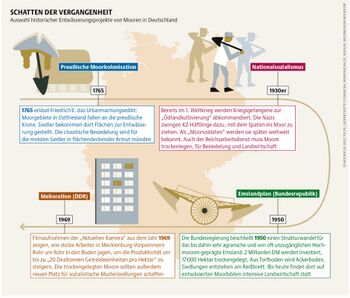

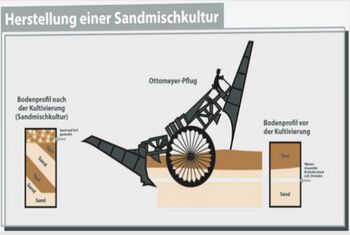
Der erste Dampfpflug war 1872 aus Leeds ins Emsland gekommen. Dieser bei Fowler entwickelte Pflug, der den Namen „Meppen“ erhielt, konnte den Boden 70 bis 80 cm tief umbrechen. Als erster Moorpflug mit speziell dafür profilierter Schar wurde ab 1948 der Tiefpflug „Mammut“ eingesetzt; in den Jahren 1959/60 wurde der kleinere Tiefpflug „Oldenburg“ konstruiert, der im Mai 1960 erstmals zum Einsatz kam.
Der sog. Kuhlpflug, Typ Mammut – gebaut 1948 von Ottomeyer – hatte eine Pflugschaar, die etwa 2 Meter Tiefe erreichte, ein Furchenrad von 4 m Durchmesser und auf der Gegenseite ein Raupenfahrwerk, um nicht im Moor zu versinken. Dieser Dampfkipp-Pflug hatte ein Gewicht von ca. 30 t, jedes der vier benötigten Lokomobile etwa 28 t. Dieses System war 1942 patentiert worden.
Nach Kriegsende wurde die Technik wesentlich verbessert. Bis in die 1970er-Jahre war der bisher größte gebaute Ottomeyer-Dampf-Pflug, der "Mammut" und der kleinere Dampfpflug "Oldenburg" in der Region im Einsatz und verwandelte die manchmal auch schon abgetorften Böden in Ackerland. Da die Mammut - Pflugschar etwa zwei Meter tief in den Boden eindrang , wurde auch der Ortstein mit aufgerissen. Das war wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Die alten Bodenhorizonte wurden durch das Pflügen vollständig gekippt und schließlich schräg gegeneinandergestellt. So entstand der Tiefumbruchboden, eine Sandmischkultur auf dem Ackerpflanzen kultiviert werden konnten.
Um das Emsland urbar zu machen, wurden die selbstgebauten gewaltige Kipp-Tiefpflüge in den Emsländer Mooren von Pfluglokomobilen gezogen. Für den Zug des Mammut-Pfluges baute die Firma Ottomeyer auch eigene Hochleistungs-Lokomobile. Die Firma veränderte und verstärkte viele bisherige Teile solcher Maschinen, um die hohe Zugleistung von je 450–500 PS je Maschine erreichen zu können. So entstanden die stärksten bisher gebauten selbst fahrenden Pfluglokomobile in Deutschland. Zwei solcher Lokomobile, mit zusammen fast 1.000 PS, zogen auf der eine Seite, zwei auf der anderen Seite ebenfalls mit fast 1.000 PS den Mammutpfluge durch das Moor. Insgesamt waren pro Pflug vier Lokomobilen mit zusammen fast 2.000 PS im Einsatz. Die Drahtseillänge betrug je nach Boden zwischen 350 und 600 Metern und war 2,4 cm stark.
Die Pfluglokomotiven selbst standen sich an den Seitenrändern der Pflug-Flächen, dem sogenannten Vorgewende gegenüber. Teilweise mussten diese Vorgewende auf den Moorflächen erst befestigt werden und waren bis zu 20 m breit. Wobei das erste Vorgewende etwas breiter war. Die Vorgewende-Flächen mussten nachgepflügt werden. Das Seil der ersten Maschine blieb – vom Antrieb entkoppelt – mit dem Pflug verbunden, dadurch wurde das Seil abgespult und zusammen mit dem Pflug zum anderen Rand des Moores zur zweiten Maschine gezogen. Dort angekommen, stoppte der Maschinist der ziehenden Maschine den Seilzug und der Pflug wurde für das Pflügen in die andere Richtung gekippt. Die beiden bis zu 600 Meter langen Drahtseile verband den Pflug mit den Lokomobilen, die ihn jeweils mit einer eingebauten dampfgetriebene Winde in ihre Richtung zogen.
Mehrere Pflüger bedienten den Pflug während des Arbeitens und sorgten mittels Fahnen oder Schildern für die Kommunikation mit den Dampflokomobilen. Die Kommunikation zwischen den Lokomobile und den Pflügern fand durch bestimmte Signale aus deren Dampfpfeifen statt.
Am Ende jeder zweiten bearbeiteten Pflugfurche fuhr die Pfluglokomotiven auf der ersten Vorgewende ein kleines Stück weiter und zog den jetzt ausbalancierten Pflug auf diese Vorgewende diagonal zur Ausrichtung auf die nächste Furche. Die Fahrstrecke entsprach mit ca. vier Metern etwa der doppelten Arbeitsbreite einer Pflugschaar. Danach richteten sie durch Seilzug den Pflug seitlich parallel zur neue Furche aus. Die Arbeiter kippten per Seilzug den Pflug zum erneuten Pflügen in Längsrichtung dann zogen das Führungs-Seil von der gegenüberliegenden Maschine an. Auch die gegenüberliegenden Maschinen waren das entsprechende Stück weitergefahren. Dieser Vorgang wiederholte sich, bis die gesamte Fläche umgepflügt war.
Die frisch umgepflügten Flächen wurden dann für die landwirtschaftliche Nutzung auch mit Dampf-Lokomobilen-Sätzen durch Walzen, Grubber und Eggen weiterbearbeitet.
Quelle: https://dampf-selbstfahrer.de/der-dampfpflug-und-andere-geraete-der-dampf-bodenkultur
Bis zu 18 Stunden lang dauern im Sommer (etwa 75 bis 100 Tage im Jahr) die Schichten der Arbeiter. Um möglichst effektiv arbeiten zu können, übernachten sie in Mannschaftswagen vor Ort - und wurden dort auch von einem Koch verpflegt. Das gesamte System bestand aus Wagen für die Festbrennstoffe, Wasserwagen, Pumpen- und Seile Karren, Mannschaftswagen, Küchenwagen und Pflug. Es gab eine Pflugmeister, mehrere Pflüger, vier Lokomobil-Führer, zwei bis vier Hilfskräfte und einen Koch. Auf dem Pflug saßen anfangs zwei Mann, ein Lenker und ein Gehilfe zum Einsetzen und Kippen des Pfluges.
In der Spitze konnte mit den Maschinensätzen des "Mammuts" in fünf Stunden etwa 1 ha Moor kultiviert und für die Landwirtschaft nutzbar gemacht werden. Mit dem Spaten hätte man für die gleiche Fläche 500 Manntage benötigt. Der Einsatz des "Mamut" lohnte sich nur auf großen Moorflächen. Neben dem „Mammut“ gab es weitere, aber kleinere Dampf-Pflüge, die später zum Pflugbetrieb auf Moor-Flächen vom direkten Zug mit Raupenschleppern abgelöst wurden.
Zwischen 1887 und 1947 tiefpflügte die Betreiberfirma Ottomeyer mit ihren Pflügen in Deutschland, den Niederlanden und Dänemark rund 200.000 ha, zwischen 1948 und 1970 waren es in der Bundesrepublik rund 100.000 ha Moore.
Ende der 1960er Jahre gab es noch über 30 Dampfpflug-Lokomotiv-Systeme in der Bundesrepublik. Mit großem Aufwand wurden mit der Maschinenhilfe von 9 Dampf-Tiefpflug-Systemen ein großer Teil der Moore in Nordwest-Niedersachsen bis 1970 weitgehend trockengelegt und kultiviert.
Die allgemeine Moorkultivierung mittels Dampfkraft endete nicht etwa wegen der Technik, sondern weil aufgrund steigender Erträge im Ackerbau die weitere Erschließung von Moorböden zur Ernährungssicherung der Bevölkerung nach 1970 nicht mehr erforderlich war.
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfpflug
https://emslandmuseum.de/2023/01/27/das-emsland-einmal-auf-links-gepfluegt/
In den 1830er Jahren schlossen sich viele Grafschafter Pastoren und Gemeinden der in den Niederlanden, in der Grafschaft und in Ostfriesland aufkommenden Abscheidungsbewegung (niederländisch: Afscheiding) an, darunter zahlreiche Reformierte in und um Uelsen, die sich dann als „altreformiert“ verstanden. Das Niederländische wurde daraufhin zur Kirchensprache und war bis Ende des 19. Jahrhunderts auch Schulsprache. In den Kirchen wurde teilweise noch 1933 auf Niederländisch gesungen und gepredigt. Daran stießen sich die Nationalsozialisten, die schließlich den Gebrauch des Niederländischen in Gottesdiensten und bei kirchlichen Feiern verboten.
Die Evangelisch-altreformierten Gemeinden entstanden ab 1838 in der Grafschaft Bentheim und ab 1854 in Ostfriesland aus den dortigen reformierten Gemeinden. Grund waren die liberalen Strömungen in der Theologie der reformierten Gemeinden, denen sich viele Gemeindeglieder widersetzten und sich daher von ihren Gemeinden absonderten. Den Anfang machte die niederländische Gemeinde Ulrum in Groningen, die sich von der reformierten Kirche am 13. Oktober 1834 trennte. Ihr Pastor Hendrik de Cock wurde zur Leitfigur der in Ostfriesland und der Grafschaft Bentheim nach ihm benannten „kokschen“ Abscheidungsbewegung (niederländisch Afscheiding).
Betont werden die Mündigkeit und Überschaubarkeit der Ortsgemeinde, die vom Kirchenrat geleitet wird. Jeder Haushalt wird alle ein bis zwei Jahre von zwei Vertretern des Kirchenrates besucht. Die Gemeindekirche lebt vom Engagement ihrer zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Missionarisch steht die altreformierte Kirche mit Gemeinden in Asien in enger Verbindung, insbesondere in Indonesien und Bangladesch. 2004 kam es als Abschluss des sogenannten „Samen op weg (Gemeinsam auf dem Weg)“-Prozesses zur Wiedervereinigung mit der Niederländisch-reformierten Kirche zur Protestantischen Kirche in den Niederlanden.” - Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hendrik_de_Cock Wikipedia - Hendrik de Cock
Der Christlich-Soziale Volksdienst (CSVD) war eine von 1929 bis 1933 bestehende protestantisch-konservative Partei in der Weimarer Republik. Bei der Reichstagswahl von 1930 gewann die betont evangelische Partei des CSVD besonders viele Stimmen in Regionen, welche durch eine starke pietistische oder freikirchliche Tradition geprägt waren. Dies waren einige ländliche Teile in Ostpreußens, in Ostwestfalen, Württemberg, Baden, Hessen-Nassau, im Siegerland und Wittgenstein, dem westlichen Ostfriesland und in der Grafschaft Bentheim der Fall. Eine teilweise antisemitische Ausrichtung, bis auf das Bentheimer Landes, gehörte zum Wesen des auftretenden CSVD. Er war bis 1933 mit 14 Abgeordneten im Reichstag vertreten, die in der Regel den Zentrums-Reichskanzler Heinrich Brüning unterstützten. siehe auch Evangelischer Volksdienst“
Während der Zeit des Nationalsozialismus stand die übergroße Mehrheit der Altreformierten im Bentheimer Land, ihrer Hochburg, als ehemalige Wähler des streng protestantischen CSVD, sie hieß hier „Evangelischer Volksdienst“ (EVD), aber in Opposition zum Dritten Reich. Die NSDAP wurde im Kirchspiel Uelsen im Gegensatz zu anderen Gemeinden nicht durch Personen unterstützt, die in der reformierten Gemeinde aktiv waren, z. B. der Pastor im Schüttorf Friedrich Justus Heinrich Middendorff (* 2. Februar 1883 in Emden; † 12. Mai 1973 in Schüttorf). Er wurde schnell über Schüttorf hinaus bekannt, da er die Schriftleitung des "Sonntagsblatts" für evangelisch-reformierte Gemeinden übernahm.
Bereits vor der Machtübernahme der NSDAP setzte sich Middendorff mehrmals öffentlich im "Sonntagsblatt" mit der nationalsozialistischen Ideologie auseinander. Auch sein Wirken im Christlich-Sozialen Volksdienst und seine Vorträge machten ihn schon bald zur Zielscheibe der NSDAP. Es folgte Überwachung durch die Geheime Staatspolizei (Gestapo) und staatliche Repressalien, der Höhepunkt der Auseinandersetzung wurde am 18. April 1937 erreicht, als fast eintausend Schüttorfer den Pastor nach einer Verhaftung und Überführung ins Rathaus mit Chorälen "freisangen". Die Ortspolizei knickte ein und ließ ihn unter Bedingungen frei. Er floh 1937, seine Familie 1938 und kehrte erst nach dem Krieg 1946 nach Schüttorf zurück. Middendorff war ein deutscher evangelisch-reformierter Theologe und von 1946 bis 1953 Kirchenpräsident der heutigen Evangelisch-reformierten Kirche, die damals noch Evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland hieß. Er wurde vor allem wegen seiner unversöhnlichen Haltung zum Nationalsozialismus bekannt.
Nach 1945 betätigten sich die meisten CSVD-Mitglieder in der CDU oder der CSU, so Gustav Heinemann (Parteiaustritt 1952), andere wie Friedrich Justus Heinrich Middendorff waren in der Friedensbewegung aktiv sowie ab 1952 in der von Gustav Heinemann und anderen gegründeten, christlich geprägten neutralistischen Gesamtdeutschen Volkspartei.
(siehe auch: Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen)
Es gab in Wielen nach dem 2. Weltkrieg zunächst eine einklassige Dorfschule mit 24 Schülern, darunter knapp die Hälfte Zoll- und Flüchtlingskinder. Bei schlechtem Wetter, wie Schneefall im Winter, konnten die Kinder in der Schule warten, bis sich das Wetter beruhigt hatte. Die kleineren Kinder bekamen dann zum Mittag in der Lehrerwohnung eine Suppe, die größeren im Klassenraum eine Stulle Brot. Vorher mussten aber immer noch längere Bibeltexte angehört werden. Der Landkreis Grafschaft Bentheim war und ist ein Zentrum der (Alt)reformierten Christen in Deutschland.

Die Schulen in der Grafschaft Bentheim waren nach dem 2. Weltkrieg nach dem Mehrheitswillen der Eltern wieder wie vorher zur Bekenntnisschulen geworden, auch um den "Flüchtlings-Religionen vorzubeugen". Die Region um Uelsen mit dem Kirchspiel Uelsen als zentraler Punkt war und ist vornehmlich evangelisch-(alt) reformiert geprägt. Im 19. Jahrhundert entstand die (alt)reformierte Kirche, mit Beendigung des zweiten Weltkrieges ließen sich auch Lutheraner und Katholiken hier als Flüchtlinge nieder. 1960 gab es in Uelsen und Umgebung 6.500 Evangelisch Reformierte, 700 Evangelisch Alt Reformierte, 900 Lutheraner und 630 Katholiken als eingetragene Gemeindemitglieder.
Nach langwierigen Diskussionen über einen Schulneubau in Wielen - die Gemeinde wünschte den Bau einer neuen zweiklassigen Schule - wurde in unmittelbarer Nähe des Heidegutes Wielen eine einklassige Schule mit Gruppenraum und Lehrerwohnung gebaut, die im Februar 1952 ihren Betrieb aufnahm. Es gelang, eine dritte Lehrkraft für Wielen zu gewinnen. Ein Klassenraum wurde angebaut. Beide Schulen wurden zu einer neuen Schule mit zwei Gebäuden zusammengefasst. In der neuen Schule wurden das 1./2. und das 5. - 8., in der alten Schule das 3./4. Schuljahr unterrichtet.
Im Mai 1963 wird in Paris ein Zollübereinkommen in der EWG unterzeichnet. Die Liberalisierung des kleinen Zollgrenzverkehrs hatte auch indirekte Folgen für die Gemeinde Wielen. Durch den Fortgang von Zollfamilien und das Abwandern von deutsch/holländischen Kindern in holländische Schulen verlor die Schule 1963 in kurzer Zeit 28 Kinder. Die 3. Lehrerstelle wurde aufgehoben. Es wurde an der alten Schule ein Campingplatz angelegt. Die Volksschule Wielen wurde in eine Grundschule umgewandelt. Nach der Grundschulzeit besuchten die Kinder aus Wielen die Schule im Schulzentrum Uelsen. Die Grundschule Wielen wurde 1977 aufgelöst. Die Schüler besuchen nun die Grundschule Wilsum und zum Teil die Grundschule Itterbeck.
Quellen: https://www.bv-wielen.de/gemeinde-wielen/schulgeschichte/

Lehrer Lindner, an der Wielener Schule ab 1952, erhielt in der Nachkriegszeit Nahrungsmittel für die Schulkinder vom Heide Gut Springorum in Wielen, dass direkt nebenan lag und eine große Gutsküche hatte. Das Heide Gut Wielen war eine Staats-Domäne, die ursprünglich den Fürsten von Steinfurt und Bentheim gehörte. Das Haus Bentheim-Steinfurt war seit 1544/1564 bis 1575 evangelisch-lutherischen Glaubens, wechselte dann aber zum evangelisch-reformierten Glauben. Das Fürstenhaus Bentheim-Steinfurt j. L. bestand bis zum Ende der Monarchie 1919. Das Gut wurde 1921 auf finanziellen Gründen aufgrund der Hyperinflation an dem deutschen Staat verpachtet.
In den 1920er Jahren wurde das Heide Gut, mit ursprünglich 421 ha Heide, von der rheinischen Industriellen Familie Springorum dank großzügiger Subventionen als Versuchsgut zur Pflanzenaufzucht auf trockenen Heideböden, weitergeführt. Einer der Väter von Bertram und Brunhilde Springorum soll aktive Mitglieder des Christlich-Soziale Volksdienst gewesen sein. Während des Krieges bestand hier ein großes Lager mit polnischen Ost-Arbeitern. Auf dem Gut waren nach dem 2. Weltkrieg viele Flüchtlinge untergebracht. Im Jahre 2023 standen Gutshaus Springorum als Resthof mit 1.223 qm Wohnfläche und der Park mit 30.000 qm für 1,3 Mio. € zum Verkauf.
Die Kinder der drei Dorfbauern von Vennebrügge gingen in Holland zur Schule. Da diese Dorfbauern deutsche und holländische Pässe besaßen, brauchten sie keine Flüchtlinge aufnehmen.
Die Hälfte der rund 600 Einwohner von Wielen besitzt im Jahre 2020 auch die niederländische Staatsangehörigkeit. Es bestehen enge Wechselbeziehungen, vor allem familiärer, religiöser und wirtschaftlicher Art, über die Grenze hinweg. Mehrere Gemeindewege führen über die „grüne Grenze“.
„Nich griene mien Marjellke - wie schaffe et!"

- Zurück nach Vennebrügge. Inzwischen war es Herbst 1946 geworden. Euer Opa und ich hatten im nahen Moor Topf gestochen; denn wir brauchten ja Brennmaterial, und der Winter stand bevor. An Kohlen war nicht zu denken! Acht Kilometer war es bis zum Moor, wir hatten nur ein Fahrrad, das Dienstrad! Es war unser einziges Verkehrsmittel „de Fiets", hieß es holländisch! Das Fahren auf dem nur „einem Rad" ging für zwei Personen immer nur abwechselnd; fahren, überholen, abstellen — zu Fuß weiter, bis man wieder zum abgestellten Rad gelangte.
- Viel später gab es aber dann ein Damenfahrrad und ein Moped (Bromm-Fiets). Darauf bin ich, Eure Oma, mit Eurem noch „kleinen Papa" auf dem Rücksitz wie die Feuerwehr auf den schlimmen ausgefahrenen Straßen, wo es nur einen schmaler Neben-Pfad zum „Fietsen" gab, entlang gebraust! Die Sturzhelmpflicht gab es noch nicht. Es ging aber immer alles gut.
- Große Achtung hatten wir vor der nahen „Holländischen kokschen Grenzbevölkerung". Auch sie waren nur auf ihre Fahrräder angewiesen, ob Jung oder Alt, alle kamen sie am Sonntagmorgen auf der Straße an unserem Haus vorbei. Die älteren Frauen in langen Röcken — eine Halbschürze davor, Bluse und Jacke und eine Haube gehörte dazu, an den Füßen hatten sie holländische Klumpen aus Holz an. Wenn's regnete, hatten sie in einer Hand noch einen Regenschirm aufgespannt! Sie fuhren zu einer bestimmte Kirche – der altreformierte Kirche in Uelsen. 1960 gab es in Uelsen und Umgebung 6.500 Evangelisch Reformierte, 900 Evangelische Lutheraner, 700 Evangelisch Alt Reformierte und 630 Katholiken als eingetragene Gemeindemitglieder. Quelle zur Reformierten Kirche: https://archive.org/details/he4diekunstden04hann/page/n276/mode/1up.
- Zufällig hatte sich auf der Straße vor unserem Zollhaus, durch Opas Hilfe bei einer Fietsenpanne, auch ein längerer Kontakt zu einer altreformierte Familien aus Hardenberg - eine holländischen Kleinstadt an der Grenze - angebahnt. Opa hatte dabei das platte Vorderrad der einen Fietse innerhalb einer Stunde geflickt, die holländische altreformierte Familien konnten nach Uelsen weiterfahren. Von da an brachte die Familie am Sonntag auf dem Hinweg zur Kirche in Uelsen immer ein Brot für uns mit, für dass sie aber kein Geld wollten. Die Familie betrieb in Hardenberg eine Bäckerei. Das Brot war in der "kargen Zeit" hochwillkommen. Bis 1948 gab es diese "Brotbeziehung" nach Holland. Die Familie ist dann leider nach Gronigen gezogen, weil sie dort die Bäckerei ihres verstorbenen Opas geerbt hatte. Ihre Bäckerei in Hardenberg wurde an ein altreformiertes Gemeindemitglied verpachtet, es wurde kein Brot mehr mitgebracht.

- Inzwischen war der November des Jahres 1947 vorbei. Die Tage waren dunkel und regnerisch. Es gab noch immer fast nichts zu kaufen; alles nur auf Bezugsscheine, die kaum zu haben waren. Ich strickte für die Bauern Strümpfe, Pullover, Schals für wenige Lebensmittel. Ein Bauer war aber geizig und rückte die Lebensmittel erst nach Nachfrage von Opa raus. Opa hatte dafür extra seine Unform angezogen und die Pistole umgeschnallt.
- In den Zollfamilien in Vennebrügge wurde in der Nachkriegszeit viel selbst gestrickt und geschneidert, man half sich auch gegenseitig. Die Männer bekamen Uniformen gestellt. Gebrauchte Kleidung konnte in Holland in Hardenberg nach der Währungsreform ab 1948 auf dem Markt auch gegen DM erworben werden. Erst Anfang der 50ziger Jahren verbesserte sich auch das Angebot in den Textilgeschäften in Uelsen. Opa kaufte dort - beim " Textilkaufhaus Heemann" - unserem Sohn zu seinem 4. Geburstag eine neuen "Bleyle-Anzug". An dem Geburtstags - Wochenende von Klaus fuhren wir per Rad nach Holland zu einem großen Vergnügungszentrum in Gronigen, mit einem großen Spielplatz. Sohn Klaus wollte aber nicht rutschen, um seinen neuen Anzug zu schonen.
- Euer Opa machte den Grenzdienst bei Wind und Wetter! Im bitterkalten Winter 1948/49 rutschte Opa während eine Nachstreife auf einer zugeschneiten gefrorene Pfütze aus, und brach sich zwei Rippe, - führte aber seinen Dienst in derselben Nacht noch zu Ende. Er mußte anschließend dreieihalb Wochen zu Hause bleiben. Vom Kommissar in Itterbeck kam nur ein gebelltes "Schlecht, Schlecht, Schlecht" und kein Ton der Anteilnahme.
- Die Grenze bestand neben die Zollämtern aus einem Grenzweg, der mit fest eingelassenen Grenzsteinen - teilweise nummeriert - markiert war. Einmal gruben die Zöllner aus Vennebrügge auf einem entlegenen Grenzweg auf deutscher Seite heimlich ein Loch, um Schmugglerautos zu stoppe und deckten es mit Zweigen ab. Der Schmugglerwagen fuhr aber in einem eleganten Bogen um das Loch herum. Diese Aktion wurde bald im Gasthaus Heideschlößchen bekannt.
- Die Grenzschutzbeamten waren mit einer Pistole und einem Karabiner und nachts mit einer zusätzlichen Taschenlampe oder Signalpistole ausgerüstet. Dazu kamen bei Bedarf Schlagstock und Knebelkette. Die Beamten sollten Schmuggler festnehmen, die unerlaubt die Grenze übertraten. Die Zöllner hatten im Zwei- später Dreischichtbetrieb als Einzel- oder Doppelstreife die etwa 20 km lange Grenze des Zollgrenzbezirks Vennebrügge zu Fuß oder per Dienstfahrrad zu bewachen. Manchmal gab es auch Streifen mit Hundeführern und Diensthunden. Der Zollkommissar aus Itterbeck übte gerne auch nachts unangemeldete Kontrollen aus. Zum Zollkommissariat Itterbeck gehörten ab 1953 auch die Nachbargemeinden Wielen und Balderhaar und es wuchs bald insgesamt auf etwa 25 Zöllner an. Sohn Klaus zeigte später für die Waffen von Opa großes Interesse, so dass schnell ein verschließbarer fester Schrank hermusste.
- Neben den finanziellen Hauptgründen waren das unbewohnte Moor- und Heidegebiet der Grafschaft Bentheim und die nicht vorhandene Zusammenarbeit der deutschen und holländischen Zollbehörden weiterer Gründe, die den Schleichhandel unterstützten. Die Schmuggler wurden in Holland nicht groß verfolgt, sie wohnten aber auf beiden Seiten der Grenze. Geschmuggelt nach Deutschland wurden hauptsächlich Kaffee, Tee, Zigaretten, Kakao und Butter, die in Holland wesentlich preiswerter waren. Geschmuggelt nach Holland wurden Teile von Autos und Maschinen, die dort wieder zusammengesetzt und preiswert verkauft wurden wurden. Geschmuggelt wurde zu Fuß, per Fahrrad, per PKW, per LKW - manchmal sogar mit Pferdefuhrwerken.

- Bis zur Währungsreform im Juni 1948 galt noch die Reichsmark. Für ein Kilo geschmuggelten Kaffee erlöste man in Deutschland bis zu 1.500 Reichsmark, für ein Pfund Butter 600, für eine „Ami-Zigarette“ acht Reichsmark. 1948 war der Umtauschkurs DM zur Reichsmark etwa 1 : 10. Am 1.7. 1953 sank die Kaffeesteuer auf 1 kg Kaffee von 10 DM auf 4 DM, der Kaffeeschmuggel lohnte sich nicht mehr. Danach wurden für die deutsche Grenzbevölkerung - auch um den Schmuggel einzudämmen - für den zollfreien kleinen Grenzverkehr mit Holland für ausgesuchte Lebens- und Genussmittel für festgelegte Mengen innerhalb bestimmter Zeiträume Genehmigungskarten ausgegeben, die beim Grenzübertritt kontrolliert wurden.
- Während seines Grenzdienste in Vennebrügge hat Opa von 1946 bis 1953 an der grünen Grenze ganze zehn Missetäter zu Fuß festnehmen können, dazu kamen noch zwei Autoinsassen, vier gestoppt Lastwagen und ein Pferdefuhrwerk. Da der Autobesitzer in Nürnberg wohnte, musste Opa zur Gerichtsverhandlung nach Nürnberg fahren. Nach eigenen Angaben sind ihm aber die Radfahrer immer entwischt, obwohl er auch Warnschüsse in die Luft abgegeben hatte.
- Es gab eine Vielzahl von unbewachten offiziellen Wegen über die grüne Grenze, die nur durch aufgestellte Schilder und Grenzsteine ausgewiesen war. Opa erzählte, dass es gemunkelt wurde, dass die Schmuggler die täglichen Einsatzpläne der Zöllner an der Grenze kannten.
- Teilweise wurde von den ortskundigen Schmugglern heimlich auch extra neue Schmugglerpfade- und Wege benutzt, so dass den Zöllnern nur das Betrachten der Fuß- und Reifenspuren übrigblieb. Die örtlichen Schmuggler – sie machten die größte Anzahl aus - bedienten in der Regel den eigenen Hausgebrauch, die überörtliche Schmuggler hatten aber geheime und sehr profitable Handelsketten aufgebaut. Die „Großschmuggler“ beförderten mit ihren Fahrzeugen zwar große Mengen, konnten aber durch die Ausweitung der Zollgrenzgebiete auf fast 30 km auch noch im Binnenland verfolgt werden.
- Dazu wurden einige spezialisierte Zollfahnder ausgebildet. Nach 1953 gehörte Opa auch eine Zeitlang dazu. Die Arbeit bestand zunächst im Aufschreiben von Adressen und Autonummern von vermeintlichen Schmugglern in der Grafschaft. Opa fand aber - da es beim Zollkommissariat in Itterbeck noch keine mobilen Funkgeräte gab - das häufige tage- und nächtelange Warten im zivilen Dienstwagen auf vermeintliche Schmugglerlastwagen ziemlich langweilig. Zum Aufwärmen wurden die Autos immer wieder angelassen werden, was der Kommissar gar nicht gern sah. Bald waren diese zivilen Dienstwagen bei den Schmugglern bekannt. Außerdem steuerten jetzt die "Großschmuggler" zunehmend Ziele außerhalb des Zollgrenzgebietes an und waren so für die Zollfahnder direkt nicht mehr zu erreichen. Sie mussten dann die örtliche Polizei einschalten, aber bis die kam …
- Nach dem Zollabkommen mit Holland von 1956 kam der Schmuggel zwischen Holland und Deutschland endgültig zum Erliege. Es lohnte sich nicht mehr. Erst mit der Verbreitung von Rauschgiften soll er ab den 90er Jahren wieder losgegangen sein. Opa kehrte 1954 auf eigenen Wunsch in die „frische Natur“ des Grenzdienstes in Vennebrügge zurück, hauptsächlich war er aber lieber in der Nähe seiner Familie. 1957 ließ Opa sich aufgrund der von allen lange vermissten städtischen Umgebung, vor allem aber wegen der besseren Schule für unseren Sohn Klaus, nach Nordhorn versetzen. In Vennebrügge war es uns zu einsam geworden.
- Die Zoll-Infos hat mir Opa so aufgeschrieben.
- Zurück nach Vennebrügge: Seit 1945 hatten wir Sorgen um meinen Vater und meinen Bruder. Beide galten als vermisst. Ob sie noch lebten? Meine Mutti war noch im Erzgebirge, bei Tante Friedel. Zwar hatten wir für Vater und Bruder Suchmeldungen an das „Rote Kreuz" nach Hamburg geschickt — aber bislang alles vergebens.
- Und eines Tages, Anfang Dezember 1947 kam über das „Rote Kreuz" Nachricht von meinem Vater — und auch zugleich über Onkel Erich, beide lebten! Vater war in Vethem, einem Ort bei Walsrode untergekommen. Mein Bruder in Lübeck in einem Lazarett als Sanitäter tätig. Sofort fuhr ich zu Vater, der bei einem Bauern lebte. Mein Gerhard, Euer Opa, konnte aus dienstlichen Gründen nicht nach Vethem mitkommen. Wieder war die Fahrt beschwerlich; aber ich bin nach 3 Tagen dort gut angekommen.
Abbildung: Benachrichtigung Deutsches Rotes Kreuz, Vorderseite [128]
Abbildung: Benachrichtigung Deutsches Rotes Kreuz, Rückseite [129]
- In Vethem angekommen fragte ich mich erstmal nach dem Bauern durch. Auf mein Klopfen an die Küchentüre trat ich ein und sah vor mir eine lange vollbesetzte Tafel, es war Mittagszeit. Ich stellte mich vor und fragte nach meinem Vater — und sah ihn am unteren Ende des Tisches sitzen. Als er seinen Namen hörte schaute er auf — und wir lagen uns in den Armen. Vaters erste Frage war nach Mutter; auch sie lebte - allerdings in Lugau in Sachsen - und wurde etwas später zu Vater nach Vethem gebracht. Mein Bruder Erich war in Lübeck gelandet. Auch er kam in Vethem unter. Unsere Lieben hatten ein gutes Leben bei Bauer „Heini" Lühmann. Ihm einen herzlichen Dank!
- Bruder Erich Tuttlies hatte in der Gegend als gelernter Maurer schnell Arbeit gefunden. Später baute sich in der Lüneburger Heide in Südkampen mit Hilfe von Dorfbewohnern, bei denen er gemauerte hatte, sein eigenes Haus. Dazu kamen Mittel des Lastenausgleichs. Wenig später ist dann Gustav Tuttlies, der zweite Bruder von Ferdinand Tuttlies in eine eigene Wohnung in das erbauten Haus mit eingezogen.
- Leider verstarb mein lieber Vater, Euer Uropa Ferdinand Tuttlies 01.08.1949 in Vethem. Eure Uroma, meine Mutter haben wir dann von Vethem zu uns nach Vennebrügge geholt. Berta Tuttlies starb am 03.07.1968 in Hamburg. Bruder Erich Tuttlies starb am 12.04.1995 Südkampen
- Ich war wieder wohlbehalten in Vennebrügge gelandet. So gab es viel zu berichten — und nun nahte schon Weihnachten; das Wiederfinden unserer Lieben war schon „ein Geschenk vom lieben Gott!" Wir waren arm, schliefen immer noch auf einem Strohsack, und waren unsagbar froh und glücklich! Und nun stand das schönste Fest aller Feste, nämlich Weihnachten vor der Türe.
- „Ohne Baum keine Weihnachten", meinte euer Opa. Also holte er einen kleinen Baum aus dem Wald. Er wurde in eine mit Erde gefüllte Konservendose gestellt. Ich schmückte ihn mit kleinen Äpfeln, die ich in flüssige Schlemmkreide getaucht hatte. Er sah prächtig aus in seinem einfachen Schmuck — ohne Kerzen und Lametta. Es war unser erster Weihnachtsbaum in unserem gemeinsamen Leben!
- Am Heiligen Abend saßen wir dann auf unseren zwei Stühlen, schon mit richtigen Sitzen! Die brennende Petroleumlampe hing an der Wand. Im Herd knisterten die Dannäpfel, die Herdtür stand offen und beleuchtete unseren Naturweihnachtsbaum. Ein Lied kam aber nicht über unsere Lippen, es fiel uns schwer – das Singen.
- Wir gingen unseren Gedanken nach — jeder für sich. Der schreckliche Krieg war vorbei, wir waren gesund geblieben und hatten uns wieder! Ich bekam aber doch nasse Augen. Euer Opa nahm mich in den Arm und sagte in seiner ruhigen Art zu mir: „Nich griene mien Marjellke — wie schaffe et!"...Und wir haben es geschafft!
- Die Zeit lief so langsam dahin. Noch immer hatten wir keine Möbel, wenig Geld, ein knappes Gehalt in Reichsmark. Es gab fast nichts zu kaufen, wenn ja nur auf Lebensmittelkarte und Bezugsschein. Doch wir hatten zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf und wir hatten ja uns — das war das Wichtigste!
- Wir hatten ein einfaches Leben auf den Lande an der holländischen Grenze - kein Rundfunk und keine Zeitungen. Das Neuste erfuhren wir im Gasthaus. Den Bauern halfen wir immer noch bei der schweren Feldarbeit gegen Naturalien; denn sie hatten nach Kriegsende keine billigen Arbeitskräfte - in Form der „ Fremdarbeiter“ - mehr. Opa half in der dienstfreien Zeit auch beim Pflügen mit Pferden, die noch vorhandenen Traktoren hatten die Engländer gleich nach Kriegsende in der Sperrzone an der Grenze eingezogen. Außerdem war das Benzin rationiert. Die Zuarbeit aus den Zollfamilien gegen Naturalien war auf den Höfen in Vennebrügge hoch willkommen. Nur der Zollamtsvorsteher meinte, es verträgt sich nicht mit seiner Position, seine Frau durfte aber zuarbeiten. Opa meinte, der Zollinspektor aus Itterbeck hatte ein besonderes Auge auf seinen Zollamtsvorsteher in Vennebrügge. Ich wurde auf den Höfen häufig auch zum Wäschewaschen gebraucht. Wir hatten ja auch noch „Franz" unser Schwein und unsere Hühner mitzuversorgen. Einmal versuchte eins unserer Schweine auszureißen und landeten in Holland, die Grenze verlief hinter dem Zollhaus.
- Bis dann am 20. Juni 1948 die große Wende eintrat. Die neue Währung war da! Die „Deutsche Mark" löste die alte Reichsmark ab. Pro Person gab es 40.- DM Kopfgeld. Die Spareinlagen betrugen für 10.- Reichsmark 1.- DM. Wir hatten keine Spareinlagen — also hatten wir auch keine DM-Gutschrift. Aber der Lebensstandard raste in die Höhe. Es gab mit einem Male alles zu kaufen, was das Herz begehrte. Lebensmittelkarten und Bezugsscheine verschwanden. Ein tüchtiger holländischer Lebensmittelhändler kam einmal pro Woche mit seinem vollen Auto vor unsere Haustür. Endlich gab es mal wieder Schokolade! Auf Bestellung brachte er auch Kleidung und andere Utensilien mit. Der wöchentliche Markt in Hardenberg auf der anderen Grenzseite war die nächste größere Einkaufsgelegenheit für die Menschen aus Vennebrügge.
- Am 25.11.1948 erhielten wir das erste Gehalt in der neuen Währung von 160,85 DM.
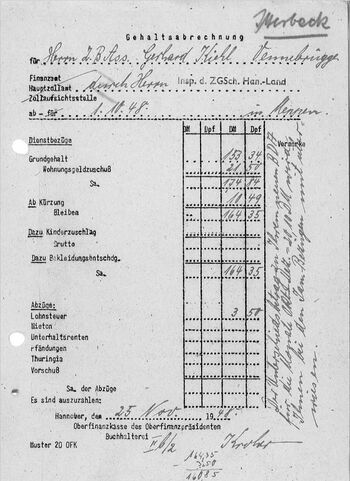
- Ja — und langsam konnten wir uns auch Möbel kaufen — auf Kredit, gefiel Eurem Opa gar nicht, aber wir haben es geschafft! Es war ein Freudentag, als zuerst die Küche dran war: Dann das Schlafzimmer, dann das Wohnzimmer, zuletzt das Kinderzimmer! Wir schwebten auf „rosa Wolken".
- Euer Papa Klaus Gerhard Kiehl kam am 13. April 1949 angerauscht. Zur Entbindung ging es vier Stunden per Pferdewagen über holprige Landstraßen ins Krankenhaus nach Hilten. Leider konnte ich danach keine Kinder mehr bekommen. Der Arzt hatte etwas vermurkst. Ich hatte mir noch drei weitere Kinder gewünscht.
- Nach Sohn Klaus kam im Herbst 1949 Oma Tuttlies nach Vennebrügge und wurde zu einer großen Hilfe für die junge Familie.
- Unsere Oma und eine Bauernoma aus Vennebrügge verstanden sich auf Anhieb. Wenn Zeit genug war, erzählte die Bauernoma aus Vennebrügge auch gerne vor früher. Ich war baff, was sie alles wusste. Viel erzählte sie auch von ihrer Schulzeit. Von ihr hörte ich auch zum ersten Mal von den Konzentrationslagern im Emsland. Ich konnte es kaum glauben. Die beiden Omas planten sogar, allein mit einem Kutschwagen zur Kirche nach Uelsen zu fahren. An einem Sonntag sollte die reformierte und am Sonntag danach die lutherische Kirche besucht werden. Leider verstarb die Bauernoma plötzlich.
- In der Gemeinde Uelsen gab es die folgende Gotteshäuser: Die evangelisch-reformierte Kirche, die evangelisch-altreformierte Kirche, die römisch-katholische St.-Antonius-Kapelle und die evangelisch-lutherische Jakobuskirche.
- Gefeiert wurde unter den Zöllnerfamilien immer zusammen. Einmal saßen wir abends bei Pancks zusammen. Sohn Klaus, der in unserer Wohnung friedlich eingeschlafen war, muß nachts wohl aufgewacht sein und hatte zuerst überall in unsere Wohnung nach uns gesucht. Er hatte sogar die Ofentüren aufgemacht und dort nachgesehen. Dann hatte er aber - Gott sei Dank - die Idee, im Schlafanzug draußen an der Wohnungstür von Pancks zu klopfen. Alle wahren danach doch sehr erleichtert.
- Der kleine Klaus war bei den Zollfamilien sehr beliebt und konnte seine Welt schon früh erobern. Er war ein genauer Beobachter. Als er kaum laufen konnte, sah er wie die Hühner aus ihrer Schüssel Wasser tranken, machte er es ihnen nach und handelte sich eine schwere Gehirnhautentzündung ein. Später stromerte er gerne mit Henki Stegink einem gleichalten Bauernsohn aus Vennebrügge auf den drei Bauerhöfen herum, was besonders von einem Bauern nicht gerne gesehen wurde. Er soll sogar gedroht haben, den Hofhund loszumachen. Die Jungs nannten ihn: „De bös Buur“. Henki ging in Holland zur Schule.
- Im Winter 1949 wurde in der Wohnung von Kiehls ein Dienststellentelefon installiert - Gerhard Kiehl wurde Postenführer in Vennebrügge. Auf dem Telefon gingen auch private Anrufe ein. Hildegard Kiehl sauste dann los, um die Bewohner zu benachrichtigen. "Er heeft iemand voor je gebeld. Es hat jemand für dich angerufen".
- Opa Kiehl hatte für den kleine Klaus eine kleine Windmühle gebaut und sie im Vordergarten aufgestellt. Als einer der Bauern mit einem Pfluggespann nach Hause kam, sollen die Pferde gescheut haben sind durchgegangen. Sie hatten sogar die Zollschranke durchbrochen. Ob es an der Windmühle lag, blieb ungeklärt. Sie wurde aber wieder abgebaut.
- Unsere Schweine wurden jährlich geschlachtet und hießen immer "Franz". Bevor deren Ende nahte, versammelte sich die Familie und Oma Tuttlies sprach ein kurzes Gebet. Nur Gerhard Kiehl und der bestellte Schlachter leiteten unter großem Quicken den Schweinetot ein. Danach half aber die gesamte Familie und die Nachbaren beim Zerlegen wieder eifrig mit. Im Waschküchenkessel wurden Brühwürste herstellt und Innereien zur weiteren Wurstherstellung in großen Töpfen gebrüht. Brühwurst und Brühe wurden in Eimern auch an die Nachbaren verteilt. Selbst zwei der Bauern waren dankbare Abnehmer. Die dritte Bauer, meinte die Würste schmecken polnisch, nahm sie aber trotzdem ab. Die entsprechenden vorgebrühten Fleischteile, Blut- und Leberwürste wurde eingeweckt – sowie im Herbst auch Obst und Gemüse. Die vom Schlachter hergestellten Rauchwürste und die frischen Schinken kamen in eine große ehemalige Eierkiste und wurden vom Schlachter zum Räuchern mitgenommen. Nach etwa zwei Monate kam die Kiste zurück und wurde mit großem Hallo geöffnet. Diese Kiste existiert heute noch, beim Enkel Simon, nur ist in ihr jetzt der Weihnachtsschmuck verpackt.

- Die monatlichen Schießübungen der Grenzschutzbeamten aus Vennebrügge auf dem Schießstand in Itterbeck starteten und endeten regelmäßig vor der Gasstätte "Heideschlößchen" der Familie Rolf. Hier wurden die Dienstfahrräder zwischengeparkt und vom Hofhund bewacht. Die Gaststätte lag auf dem Weg von Vennebrügge nach Uelsen. Uelsen lag an der historischen Heer-, Hanse- und Poststraße Lingen – Uelsen - Zwolle – Amsterdam. Vor und nach dem 1. Weltkrieg wurde diese Straße wurde nicht nur von der Postkutsche oder von schweren Frachtfuhrwerken, sondern auch von den "Pickmaijern" (Hollandgängern) stark benutzt. So berichtete die Familie Rolf. Im Heideschlösschen fanden nach Abzug der Polen 1946 auch wieder die Gemeindeversammlungen und die Tanzveranstaltungen von Wielen statt.
- Die Gaststätte war auch bei den holländischen Nachbaren sehr beliebt, da hier der Alkoholausschank und Flaschenkauf, im Gegensatz zur angrenzenden holländischen Provinz, nicht wesentlich begrenzt war. Vor der Gaststätte hatten die Wirtsleute auf der anderen Straßenseite einen großartigen Spielplatz für Kinder angelegt. Jeden zweiten Sonntagvormittag fuhren die Väter Panck und Kiehl mit ihren Söhnen per Fahrrad zur Gaststätte. Auf den Herrenrädern war hinter dem Lenker ein Schalten-Kindersitz auf der Querstange angeschraubt, für die Füße gab es Fußrasten an der Lenkgabel. Die Väter tranken dann drei Biere und die Söhne bekamen jeder eine halbe Tafel Schokolade. Auf dem Heimweg gab es dann zwischen Vätern kleine Radrennen, angefeuert von ihren Söhnen. In der Gaststätte sah Sohn Klaus mit seinem Vater an einem Sonntag auch den ersten Kinostreifen seines Lebens und zwar kurze Trickfilme von Walt Disney. Der Film soll von den Amerikanern nach Deutschland zur "Politerziehung" gebracht worden sein und musste durch die Filmverleiher sofort verteilt werden. Nur wenige Deutsche hatten zuvor amerikanische Trickfilme gesehen. Die Filmansicht kostete für Kinder 20 und für Erwachsene 50 Pfennige. Am 28.12.2016 schloss nach 120 Jahren die Gaststätte Heideschlößchen" der Familie Rolf.

Quelle: http://www.uelsen-und-umgebung.de/historisch/index.html
- Klaus wurde dann später in Wielen, 4 km entfernt, eingeschult. Die Schule lag direkt neben dem Heide Gut Springorum in Wielen und hatte eine reformierten Lehrer. Zuerst musste Klaus aber lernen Fahrrad zu fahren, denn für den Schulweg war er auf seinen Drahtesel der Marke "Rixe" angewiesen! Opa hatte ihn gründlich in das Fahrradputzen und Reparieren eingewiesen, so dass sein Drahtesel noch 1960 in Hamburg voll einsatzfähig war. Wir drei sind dann immer noch mit unseren Fahrrädern zu unserem Kleingarten am Niendorfer Gehege in Hamburg gefahren.
- Sohnemann Klaus begegnete einmal auf seinem Schulweg nach Wielen am Morgen einer riesige Staubwolke aus der tiefes Motorenbrummen kam. "Das sind die Russen" dachte er sofort aufgrund aufgeschnappter Gespräche. Er kehrte aber nicht um, sondern blieb mit seinem Fahrrad am Straßenrand stehen, denn er hatte auch gehört, die Russen seien "kinderfreundlich". Es waren aber "nur" Raupenschleppen, die mit einem riesigen hochgestellten Tiefpflug zum Moorpflügen unterwegs waren. Opa und ich sprachen noch lange über diesen Vorfall.
Zwei Enkel, zwei Ur-Enkel und die Heimatgruppe Insterburg füllen mein Leben aus
- Hildegard Kiehl berichtet weiter:
- Euer Opa wurde 1956 noch für kurze Zeit nach Nordhorn versetzt. Häufig besuchten wir dort die Zoll-Familie Panck aus Vennebrügge, die ins nahe Bentheim versetzt worden war. Und dann ging Opa nach Hamburg ins „Hauptzollamt-Oberelbe", zuletzt war er dort Zoll-Amtsrat. Wir bekamen 1958 eine Wohnung in der Eduardstraße in Hamburg Eimsbüttel, in der ich bis heute lebe. Bisher krame ich aber immer noch gerne in meinem alten Kopf nach alten Erinnerungen. Der Pflegedienst kommt auch regelmäßig, und sieht nach, ob ich noch alles richtig mache.
- Das war mein Leben in kurzen Zügen. Inzwischen bin ich 100 Jahre jung geworden! Mein Gerhard, unser lieber Opa, ruht nun schon fast 22 Jahre. Ich fühle mich aber nicht einsam, denn ich habe ja meinen Sohnemann Klaus und schon Ur-Enkel, bisher zwei an der Zahl. Es könnten aber auch gerne mehr werden! (Neben Camila und Mateo kam 2024 Alma dazu) Ihr alle füllt mein Leben aus. Sehr viel gibt mir auch meine „Insterburger Heimatgruppe, mit der ich noch regelmäßig op Platt telefoniere und zwei nette Nachbarinnen mit denen ich viel ratsche. Ick freu mi imma, wenn de Sonn schient, un wenn ick mi nich freun tät, schient de Sonn aber doch ooch! Moket et jood!
Hildegard Kiehl, geb. Tuttlies, geboren am 21.03.1920 in Willschicken, gestorben am 19.06.2021 in Hamburg, wohnte zuletzt in der Eduardstr 41 c, in 20257 Hamburg.

Hildegard Kiehl hatte nach der Flucht aus Ostpreußen in Hamburg viel von zu Hause aufgeschrieben, in Bibliotheken gestöbert, Verwandte und Bekannte ausgefragt und ist in ihre alte Heimat gefahren. Sie hat sich für die Heimatliteratur und Zeitschriften interessiert und begrenzt Fachbücher und graue Literatur erworben. Sie hat in Heimatzeitschriften kleine Artikel veröffentlicht und hat in ihrer Heimatgruppe viel berichtet. Sie hat "genealogisch geforscht" und hat die Ergebnisse in den "Tuttliesen Nachrichten 1 - 6" verteilt, die leider vergriffen sind. So hat sie alle damaligen deutschen Telefonbücher nach dem Namen Padefke (Mutter von Gerhard Kiehl) durchsucht und hat wochenlang zur Ahnenforschung im Preußischen Staatsarchive in Berlin und bei den Mormonen in Hamburg gearbeitet. Alle interessanten Funde wurden - soweit möglich - telefonisch oder schriftlich befragt - etwa 950 Adressen. Etwa ein Drittel hat auch geantwortet. Ihr Mann Gerhard Kiehl hat sie dabei tatkräftig unterstützt. Es entstand eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Klaus-Peter Podewski, einem Mathematiker der Uni Hannover. Das Internet haben aber beide noch nicht benutzt. Ein Arbeitsergebnis der Familienforschung zu den Familien Padefke/Podewski (Stand 1986), kann per E-Mail von klaus-kiehl@t-online.de erbeten werden. Weitere genealogische Ergebnisse zu den Familien Tuttlies und Burba (Stand 2020), sind auch in GenWiki zu finden
Die Fotos und die Abbildungen wurden zum Teil von früheren Artikeln übernommen und die markierten Textstellen wurden nachträglich von Klaus Kiehl eingefügt. In der Hoffnung, dass alle Angaben und Quellen richtig eingeordnet sind, sind Berichtigungen und neue Informationen herzlich willkommen.
Bitte senden Sie diese an die E-Mail-Adresse von Klaus Kiehl: klaus-kiehl@t-online.de
Text- Quellen zu Willschicken
- ↑ Chronik Ksp. Aulenbach (Ostp.) Wilkental, 1939, Karte: Messtischkarte Nr 1196-1197 Auschnitt Umgebung http://www.davidrumsey.com)©2010 Cartography Associate
- ↑ Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches 1912 http://Meyer%20Orts-%20und%20Verkehrslexikon%20(1912
- ↑ Wilschiken o. Wilkschicken o. Wilpischen auf der Schroetterkarte (1796-1802), Maßstab 1:50 000 © Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
- ↑ Chronik Ksp. Aulenbach (Ostp.) - Wilkental, 1939 - KARTE: Messtischkarte Nr 1196-1197 Gemeindegrenzen V2 https://wiki.genealogy.net/Datei:Chronik_Ksp._Aulenbach_(Ostp.)_-_Wilkental_-_1939_-_KARTE_-_Messtischkarte_Nr_1196-1197_Gemeindegrenzen_V2.jpg
- ↑ Datei-Aulenbach (Ostp) Kirchspiel Aulenbach Evang. Kirche 2 https://wiki.genealogy.net/Aulow%C3%B6ne
- ↑ Kurt Henning, Charlotte Henning: Der Landkreis Insterburg, Ostpreußen. Ein Ortsnamen-Lexikon. o. O. [Grasdorf-Laatzen] o. J. [1981] https://kat.martin-opitz-bibliothek.de/vufind/Record/0075713/Details
- ↑ Chronik Ksp. Aulenbach (Ostp.) - Willschicken - 1927 - DOKUMENT - Orts- u. Adressbuch Lks Insterburg Seite 68 Ausschnitt
- ↑ Schadensberechnung Landwirtschaft 1 privat Reinhard Mattulat, Römerstein
- ↑ Schadensberechnung Landwirtschaft 2 privat Reinhard Mattulat, Römerstein
- ↑ Chronik Ksp. Aulenbach (Ostp.) - Wilkental - 1939 - KARTE - Messtischkarte Nr 1196-1197 Gemeinde mit Höfenummerierung V2 http://www.davidrumsey.com) © 2010 Cartography Associate
- ↑ Nach den Angaben ehemaliger Einwohner von Wilkental (Hildegard Kiehl, geb. Tuttlies) - unter Zuhilfenahme des Einwohner- und Ortschaftsverzeichnisses (1935) des Ostpreußischen Tageblatts, Sturmverlag
- ↑
Messblatt Wilkental neu https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php
- ↑ Berta Tuttlies Foto privat um 1930
- ↑ Ferdinand Tuttlies Foto privat um 1930
- ↑ Foto: Talka beim Bau des Wohnhauses Tuttlies, Quelle privat um 1904
- ↑ Foto: Burbas Frauen als Hilfskräfte beim Hausbau, Quelle: Foto privat um 1904
- ↑ Foto: Talka beim Bau des Stallgebäudes, Quelle: Foto privat um 1904
- ↑ Willschicken - 1906 - Foto: Hof Tuttlies Beladen der neuen Scheune
- ↑ Willschicken 1910, Foto: Innenhof der neue Bauerstelle Tuttlies Scheune, Hoftor und Stall, Berta Tuttlies mit Enkeln Carlhorst und Brunhilde
- ↑ Willschicken 1930, Foto: Der Tuttliesen Hof aus der Ferne - im Vordergrund Hildegard Tuttlies mit ihrer Lieblingskuh "Lisa"
- ↑ Köllmann, Bevölkerungsgeschichte https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00048890_00003.html
- ↑ Ziegelei Teufel http://wiki-alt.genealogy.net/Datei:Uszup%C3%B6hnen_1920-00-00_001_Teufels_Ziegelei_.JPG
- ↑ Genossenschaft https://wiki.genealogy.net/Aulow%C3%B6nen
- ↑ Was verdiente ein Arbeiter (www.was-war-wann.de)
- ↑ Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschafts-Geschichte Band 2
- ↑ Hans Bloech: Ostpreußens Landwirtschaft, Teil 1
- ↑ Feldarbeit Foto Privat
- ↑ Dreschen in der Scheune Foto privat https://dampfdreschen.de/dreschen-wies-frueher-war/
- ↑ Jens Dangschat u.a.: Aktionsräume von Großstadtbewohnern
- ↑ Aktivitätsarten und Aktivitätsorte der Familie Tuttlies 1930, Entwurf Klaus Kiehl, 2023
- ↑ Messtischblatt Lindenhöhe https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php
- ↑ Die Konfirmandin Hildegard Tuttlies (1934)
- ↑ Konfirmand Gerhard Kiehl (1928)
- ↑ Das Hochzeitspaar Hildegard Tuttlies und Gerhard Kiehl (1943)
- ↑ Verzeichnis der Hofbesitzer der Gemeinde Paducken (1944)
- ↑ Messtischblatt Paducken https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php
- ↑ Messtischblatt Klein Schunkern https://www.landkartenarchiv.de/deutschland_messtischblaetter.php
- ↑ Dörfer: Uszupöhnen, Gr. Aulowönen, Alt Lappönen, Willschicken 1893 http://www.davidrumsey.com) © 2010 Cartography Associates
- ↑ Schwarznecker und Reck Tankstelle https://wiki-alt.genealogy.net/Datei:Aulow%C3%B6nen_-_Postkarte_002.JPG
- ↑ Schwarznecker und Reck Tankstelle https://wiki.genealogy.net/Datei:Aulow%C3%B6nen_-_Ksp._Aulenbach_-_1932-05-01_-_Schwarznecker_%26_Reck_Tankstelle.jpg
- ↑ Zeugnis Gerhard Kiehl, Foto privat
- ↑ Orte Keppurlauken - Neu Lappönen - Willschicken (1893) http://www.davidrumsey.com) © 2010 Cartography Associates
- ↑ Zuchtstute Herold https://wiki.genealogy.net/Birkenhof_(Ostp.)#Geschichten_.26_Anekdoten_rund_um_Birkenhof
- ↑ Hildegard Tuttlies mit den Enkeln Manfred und Carlhorst und der Trakener Hof-Stute Rieke, Foto: privat
- ↑ Deutsche Dialekte https://de.wikipedia.org/wiki/Hochpreu%C3%9Fisch#/media/Datei:Deutsche_Dialekte_1910.png
- ↑ W. Ziesemer: Die ostpreußischen Mundarten. In: Ostpreußen. Land und Leute in Wort und Bild. Mit 87 Abbildungen. Dritte Auflage, Gräfe und Unzer, Königsberg (Preußen) o. J. [um 1926]
- ↑ Preußisches Wörterbuch: Deutsche Mundarten Ost- und Westpreußens. Hrsg. von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Begr. von Erhard Riemann. Fortgef. von Ulrich Tolksdorf. Hrsg. von Reinhard Goltz. 6 Bände. Wachholtz-Verlag Neumünster 1974–2005.
- ↑ Annaberger: Annalen: Jahrbuch über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Nummer 11, 2003, ISSN 0949-3484, Gerhard Bauer, Quelle: AnnabergNr.11_Kap5.pdf (annaberger-annalen.de)
- ↑ Chronik Ksp. Aulenbach (Ostp.) https://warfarehistorynetwork.com/article/the-battle-of-tannenburg-massacre-in-the-marshes/
- ↑ Das Soldatengrab vor dem Wohnhaus der Familie Tuttlies 1915, Foto: privat
- ↑ Kossert: ZEIT 13.02.2014
- ↑ Erinnerungen https://de.wikipedia.org/wiki/Ged%C3%A4chtnis, abgerufen 01.06.2023
- ↑ Familie Tuttlies in ihrem Garten, Foto privat
- ↑ Hundehütte vom Hofhund Rolf, Foto privat
- ↑ Wohnhaus der Familie Tuttlies, Foto privat
- ↑ Der Gasthof Fritz Lerdon, Foto: privat
- ↑ Wirtsleute, Foto: privat
- ↑ Schulweg, Foto: privat
- ↑ Der ehemalige Schulweg
- ↑ Personal-Karte Lehrer Wiederhöft
- ↑ Schule in Lindenhöhe 1930, Foto: privat
- ↑ Schüler der Schule in Lindenhöhe 1930
- ↑ Fasching der Handelsschulkasse in Insterburg 1938, bei den Tuttliesen Max zu Hause, Foto: privat
- ↑ Hildegard mit Zöpfen, Foto: privat
- ↑ Hildegard mit ihrer Puppe, Foto: privat
- ↑ Hildegard Tuttlies und Gerda Weinowski und mit Sonntagspuppe Foto: privat
- ↑ Schlittenfahrt https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=russki&id=100057
- ↑ Foto: privat
- ↑ Foto: privat
- ↑ Gaststätte Fritz Lerdo, https://www.bildarchiv-ostpreussen.de/suche/index.html.de?qp=searchtext%3D12%3Afritz%20lerdonmode%3D1%3Af#!start=1
- ↑ Nachruf Scharffetter https://wiki.genealogy.net/Datei:Kallwischken_-_Ksp._Aulenbach_-_1934_-_Nachruf_Johann_Scharffetter.jpg
- ↑ Zigeuner in Tharau https://www.tharauvillage.de/kreise-und-orte/kreis-preu%C3%9Fisch-eylau/einwohner-tharau/
- ↑ Foto: privat
- ↑ Foto: privat
- ↑ Pristanien am Mauersee https://wiki.genealogy.net/Pristanien
- ↑ Mitarbeiterinnen der Baumschule Wenk
- ↑ Zeugnis der Baumschule Wenk
- ↑ Flagge von Insterburg RUS Chernyakhovsk flag - Черняховск — Википедия (wikipedia.org)
- ↑ Stadtwappen von Insterburg 70 Пфенu)нигов 1921, Инстербург подробное описание (notescollector.e
- ↑ Rückseite von Notgeldschein 70 Pf. 70 Пфенu)нигов 1921, Инстербург подробное описание (notescollector.e
- ↑ Räumungsbefehl, https://www.tharauvillage.de/kreis-preu%C3%9Fisch-eylau/kreuzburger-erinnerungen/
- ↑ Ausweis für Umquartierte, Dokument: privat
- ↑ Reichsbahn Flugblatt (1943) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichsbahn_als_Teil_der_Front.jpg
- ↑ Herausgegeben vom Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Band I/1 Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße. Band 1, Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1954.
- ↑ Zentrum gegen Vertreibung: Die Flucht der ostpreußischen Bevölkerung
- ↑ Soldaten der Wehrmacht in Wilkental auf dem Hof
von Bürgermeister Mikuteit (1944) Foto: privat - ↑ Soldaten der Wehrmacht in Wilkental vor dem Hof von Ferdinand Tuttlies? Foto: privat (1944)
- ↑ Wikipedia: Flucht und Vertreibung Deutscher aus Mittel- und Osteuropa 1945–1950
- ↑ Flucht aus Ostpreußen http://doku.zentrum-gegen-vertreibung.de/archiv/oderneisse1/kapitel-4-1-4-2-2.htm
- ↑ Wikipedia: Gauleiter Erich Koch
- ↑ Die WELT-Geschichte: Flucht aus Ostpreußen: 62 Minuten dauerte der Todeskampf der „Gustloff“
- ↑ Hafen von Pillau [https://de.wikipedia.org/wiki/Baltijsk#/media/Datei:Pillau_(Karte).jpg Karte Hafen von Pillau
- ↑ Verladung in Pillau https://de.wikipedia.org/wiki/Baltijsk#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild_146-1989-033-33,_Pillau,_Hafen,_Fl%C3%BCchtlinge.jpg Wikipedia: Baltijsk / Pillau (Einschiffung von Flüchtlingen)
- ↑ Flucht über die Ostsee https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1972-092-05,_Flucht_aus_Ostpreu%C3%9Fen.jpg Wikipedia: Baltijsk / Pillau (Einschiffung von Flüchtlingen
- ↑ Wilhelm Gustloff https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gustloff_(Schiff)
- ↑ Eisenbahnstiftung: Flüchtlinge im offenen Güterwagen https://eisenbahnstiftung.de/bildergalerie/Reichsbahn%20im%20Krieg?search=&br=&page=2
- ↑ Eisenbahnstiftung: Flüchtlinge im Zug von Stettin nach Lübeck"> https://eisenbahnstiftung.de/bildergalerie/Reichsbahn%20im%20Krieg?search=&br=&page=2
- ↑ Ankommende und abfahrende Flüchtlinge am Bahnhof in Bamberg nach Kriegsende https://eisenbahnstiftung.de/bildergalerie/Reichsbahn%20im%20Krieg?search=&br=&page=1
- ↑ Transport in die Vernichtungslager https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reichsbahn_(1920%E2%80%931945)#/media/Datei:Yad_Vashem_-_Denkmal_zur_Erinnerung_an_die_Deportierten.jpg
- ↑ Flüchtlingsaufnahme http://www.kreisgemeinschaft-wehlau.de/Flucht-Vertreibung/900-0077%20Aufteilung%20der%20Vertriebenen%20auf%20die%20vier%20Besatzungszonen%20nach%20der%20Volkszaehlung%20von%201946..html
- ↑ Gewährung von Unterstützung, Foto: privat, 1945
- ↑ Benachrichtigungstelegramm über Einstellung von Gerhard Kiehl beim Zoll, Foto: privat
- ↑ Landkreis Grafschaft Bentheim https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Grafschaft_Bentheim
- ↑ Vennebrügge https://www.bing.com/search?q=vennebr%C3%BCgge+karte&form=ANNTH1&refig=446b8a1778da4f3985e5911bc5cabffa&pc=U531
- ↑ Emslandlager https://bodenspuren.nghm-uos.de/exhibits/show/lagersystem-emsland-1933-1945/das-lagersystem-im-emsland
- ↑ Emslandlager https://www.google.de/maps/@52.7881885,7.7044829,9z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDgyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
- ↑ 1. Polnische Panzerdivision https://en.wikipedia.org/wiki/1st_Armoured_Division_(Poland)
- ↑ Kirchenbau in Friesoythe https://www.porta-polonica.de/de/atlas-der-erinnerungsorte/kacperkowo-194546-als-ein-dorf-im-emsland-polnisch-war
- ↑ Westverschiebung von Polen https://de.wikipedia.org/wiki/Zwangsumsiedlung_von_Polen_aus_den_ehemaligen_polnischen_Ostgebieten_1944%E2%80%931946
- ↑ Wiederinstandgesetztes Zollbeamtenhaus in Vennebrügge 1952, Quelle: Foto privat
- ↑ Emsland https://de.wikipedia.org/wiki/Hochstift_M%C3%BCnster
- ↑ Grafschaft Bentheim 1794 https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Bentheim
- ↑ Emsland https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Emsland
- ↑ Bakker-Schut Plan https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Annexionspl%C3%A4ne_nach_dem_Zweiten_Weltkrieg
- ↑ Kanalnetz https://de.wikipedia.org/wiki/Linksemsisches_Kanalnetz
- ↑ Heuerleute http://www.heuerleute.de/das-heuerlingswesen/wohnen-und-leben-der-heuerlinge/
- ↑ Deutz F 41 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutz_F1M_414_2013-07-21_14-01-10-crop.jpg
- ↑ Lanz Bulldog https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lanz_Bilder2007_008-crop.jpg
- ↑ Big Bud Traktor 16V-747 https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Bud_747#Hersteller
- ↑ Kultivierung https://www.boell.de/de/mooratlas#infografiken
- ↑ NDR Archiv https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Emslandplan-Das-Armenhaus-der-Repuplik-wird-Boom-Region,emslandplan100.html
- ↑ Tiefumbruchboden https://www.emsland.com/urlaub/natur-aktiv/geopark-emsland/geo-tipps/tiefumbruchboden-im-fullener-wald
- ↑ Postkarte: Alte Schule in Wielen und Campingplatz Alte Schule in Wielen http://uelsen-und-umgebung.de/historisch/alte-ansichten/index.html
- ↑ Heide Gut Springorum http://www.uelsen-und-umgebung.de/historisch/alte-ansichten/ansicht163.html
- ↑ Evangelisch reformierte Kirche in Uelsen https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelisch-reformierte_Kirche_(Uelsen)
- ↑ Bezugsschein https://emslandmuseum.de/2021/01/26/tauschwirtschaft-und-schwarzmarkthandel Emslandmuseum Lingen, Bezugsschein
- ↑ Schmuggler https://www.geschichte.be/schmuggel-an-der-deutsch-belgischen-grenze/
- ↑ Benachrichtigung Deutsches Rotes Kreuz, Vorderseite Quelle: privat, 1947
- ↑ Benachrichtigung Deutsches Rotes Kreuz, Vorderseite Quelle: privat, 1947
- ↑ Gehaltsabrechnung Gerhard Kiehl, 01.10.1948, Quelle: privat
- ↑ Heideschlößchen http://uelsen-und-umgebung.de/historisch/alte-ansichten/ansicht110.html
- ↑ Klaus Kiehl mit Fahrrad 1955 Quelle: privat
- ↑ Goldene Hochzeit von Hildegard und Gerhard Kiehl, 1993 in Hamburg , Quelle: privat
Bibliografie zu Willschicken
- Suche nach 'willschicken' in Metadaten und Volltexten | MDZ (digitale-sammlungen.de)
 nach dem Ort:
nach dem Ort: - Willschicken in Grübels Gemeindelexikon des Deutschen Reiches (Seite 529)
- Ostpreußen: retro|bib - Ergebnis der Suchanfrage (retrobibliothek.de)
- Insterburg: retro|bib - Ergebnis der Suchanfrage (retrobibliothek.de)
Karten zu Willschicken
Dokumente zu Willschicken
Niekammer´s Band III - Provinz Ostpreußen (1922) Deckblatt Quelle: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=1203
Niekammer´s Band III - Provinz Ostpreußen (1922) Seite 130 Quelle: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=1203
Niekammer´s Band III - Provinz Ostpreußen (1922) Seite 131 Quelle: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=1203
Quelle : In "Niekammer´s Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher Band III - Provinz Ostpreußen, 1922 Lindicken (Ostp.)(Seite 129-130)
Genealogische und historische Quellen zu Willschicken
Standesamt Unterlagen / Zivilstandsregister (ab 1874)
Das für Willschicken (Wilkental) zuständige Standesamt war ab 1888 gemäß der Zuordnung des AGOFF das StA Gross Aulowönen. Die Bestände sind teilweise, trotz Kriegseinwirkungen, erhalten und seit 2015 digitalisiert worden. Sie können gegen Gebühr (Mitgliedschaft) bei Ancestry unter StA Gross Aulowönen eingesehen werden.
Kirchenbuchbestände
Die für Willschicken (Wilkental) zuständige evangelische Kirchengemeinde war Aulowönen / Aulenbach (Ostp.). Viele Bestände wurden im Digitalisierungsprojekt “Archion” der deutschen evangelischen Kirchen online gestellt, leider keine Bestände aus Aulowönen. Es gibt jedoch ebenfalls gegen Gebühr (Mitgliedschaft) bei Ancestry unter Gross Aulowönen einsehbare Bestände. Außerdem befinden sich einige Unterlagen im Sächsischen Staatsarchiv in Leibzig, siehe auch: Sächisches Staatsarchiv - Kirchenbuchbestände Landkreis Insterburg
Adressbücher
- Einträge aus in der Adressbuchdatenbank.
Quelle : In Einwohner- und Ortschaft-Verzeichnis des Landkreises Insterburg, Sturmverlag GmbH, 1935
Quellen zum Anhang
- Niekammer´s Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher Band II - Provinz Ostpreußen (1922) auf der Webseite Digitalisat der Elbląska Biblioteka Cyfrowa (Digitale Bibliothek der Elbinger Stadtbibliothek)
- Niekammer´s Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher Band III - Provinz Ostpreußen (1932) auf der Webseite Digitalisat der Elbląska Biblioteka Cyfrowa (Digitale Bibliothek der Elbinger Stadtbibliothek)
- Landkreis Insterburg auf der Webseite Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 - 1945: Rolf Jehke, Herdecke., 2005
- Amtsbezirk Groß Franzdorf (Franzdorf) auf der Webseite Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 - 1945: Rolf Jehke, Herdecke., 2005
- Pillkallen auf der Webseite GenWiki, Portal Pillkallen, Kapitel 17: Die letzten 25 Jahre bis zum Untergang 1945
- Waldfrieden auf der Webseite Ortsinformationen nach D. LANGE, Geographisches Ortsregister Ostpreußen, 2005
Weiteren Kontakte
Zufallsfunde
Oft werden in Kirchenbüchern oder anderen Archivalien Personen oder Sachverhalte gefunden, die nicht aus den bearbeiteten Orten oder Gebieten stammen. Diese Funde nennt man Zufallsfunde. Solche Funde sind für andere Familienforscher manchmal wichtig und können ihnen weiterhelfen. Falls Sie Zufallsfunde zu Willschicken finden wäre es freundlich, sich bei Klaus Kiehl zu melden.
Private Informationsquellen- und Suchhilfeangebote
Auf GenWiki können sich auch private Familienforscher eintragen, die zu Willschicken eigene Forschungen betreiben und/oder die bereit sind, anderen Familienforschern Informationen, Nachschau oder auch Scans bzw. Kopien passend zu diesem Ort anbieten. Nachfragen sollten bitte ausschließlich an den entsprechenden direkt Forscher gerichtet werden.
Bericht zur ländlichen Entwicklung in Ostpreußen am Beispiel des Dorfes Willschicken
In Ergänzung zu den vorgenannten Texten siehe auch den nachfolgenden Link zu einigen Hintergrundinformationen: Ländliche Entwicklungen in Ostpreußen, dargestellt am Beispiel von Willschicken (Ksp. Aulenbach Ostp.) – GenWiki (genealogy.net)
Wir suchen noch Fotos von Wilkental / Willschicken (Kreis Insterburg) für eine Veröffentlichung an dieser Stelle. Sollten Sie Bilder oder interessante Informationen haben, würden wír uns über eine Kontaktaufnahme freuen. In diesem Fall senden Sie bitte eine E-Mail-Adresse an Klaus Kiehl: klaus-kiehl(at)t-online.de
Vielen Dank für Ihr Interesse